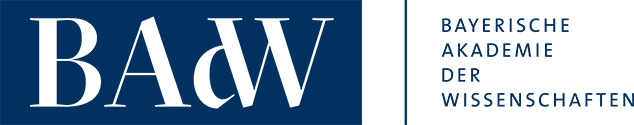[1]Einleitung
1. Der biographische und werkgeschichtliche Hintergrund
Die in diesem Band versammelten Schriften, Diskussionsbeiträge und Stellungnahmen Max Webers fallen in eine Zeitspanne, die von zwei unterschiedlichen Lebenssituationen des Autors begrenzt ist. Am Beginn steht Max Webers schwere psychische Krankheit, am Ende seine Arbeit an den Beiträgen für den späteren Grundriß der Sozialökonomik, die er selbst als wahrhaft neu einstufte und die seinen heutigen Weltruhm mit begründeten. Im Jahre 1900, als er die „Vorbemerkung des Herausgebers“ zu Walter Abelsdorffs Dissertation veröffentlichte, konnte er schon seit längerer Zeit nicht mehr wissenschaftlich arbeiten. Selbst für die Rezeption wissenschaftlicher Literatur fehlte die Kraft. Tief hatten die seit 1898 sich mehrenden Krankheitsattacken seine Arbeitsfähigkeit untergraben.
1
Es war zu diesem Zeitpunkt keineswegs ausgemacht, ob Wissenschaft für ihn jemals wieder ein Beruf würde sein können. 1902 versuchte er sich zunächst über Rezensionen, die in diesem Band abgedruckt sind, wieder in wissenschaftliche Arbeit einzustimmen. Dennoch verzichtete er 1903, als er sich zwar merklich besser, aber keineswegs verläßlich arbeitsfähig fühlte, auf das Ordinariat für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft an der Universität Heidelberg. Fortan war er zwar noch Honorarprofessor, aber ohne Sitz und Stimme in der Fakultät zu haben und ohne Lehrveranstaltungen abzuhalten. Allerdings hatte er wieder zu schreiben und zu publizieren begonnen. Auch wirkte er vermehrt in außeruniversitären wissenschaftlichen Zusammenhängen, so etwa, seit 1904, als Mitherausgeber des Archivs für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, das, ähnlich der Année sociologique unter dem Einfluß von Emile Durkheim in Frankreich, unter seinem Einfluß zu der wohl führenden sozialwissenschaftlichen Zeitschrift in Deutschland avancierte, oder als Mitglied des Vereins für Sozialpolitik, dem er schon seit der Zeit vor der Jahrhundertwende angehörte und der ihm nun wieder ein willkommenes Forum für die Initiierung von großangelegten Forschungsprojekten[1] Dazu Weber, Marianne, Lebensbild1, S. 239–277, Kap. „Absturz“.
2
sowie von sozialwissenschaftlichen und vor allem sozialpolitischen Interventionen bot. Vgl. dazu MWG I/11.
[2]Im Jahre 1912, als er noch einmal einige Gleichgesinnte zu einer Aussprache aufrief, um die aus seiner Sicht eingetretene sozialpolitische Stagnation in Deutschland zu überwinden, als er sich bereits wieder von der von ihm mitgegründeten Deutschen Gesellschaft für Soziologie zurückgezogen hatte, steckte er tief in den Arbeiten für den späteren Grundriß der Sozialökonomik. Wenn nicht alles täuscht, fühlte er sich nun trotz äußerer Ablenkung, etwa durch seine zeitraubende Beteiligung an Gerichtsprozessen, und trotz immer wiederkehrender innerer Lähmung in einer Phase gesteigerter Kreativität.
3
[2] Vgl. dazu die Briefe und Dokumente in MWG II/7.
Die Zeitspanne ist also nicht allein von zwei radikal unterschiedlichen Lebenssituationen markiert, in ihr vollzieht sich auch eine Entwicklung. Nicht nur, daß Max Weber sein Lehramt als Nationalökonom 1903 aufgab und nie wieder aufnahm,
4
er überschritt auch die Grenzen dieser Disziplin in Richtung auf eine, allerdings neu zu begründende, verstehende Soziologie, die sich von den zu dieser Zeit gängigen Soziologien unterschied. Diese für das Werk entscheidende Entwicklung spiegelt sich auch etwa in den logisch-methodischen Aufsätzen von 1903 bis 1907 Die Berufung auf den Lehrstuhl in München 1919 nahm er nur unter der Bedingung an, daß er nicht Nationalökonomie lehren müsse. Vgl. MWG I/17, S. 20.
5
oder in den Studien über die Ethik des asketischen Protestantismus von 1904/1905, MWG I/7.
6
an die sich eine bis 1910 andauernde Kontroverse anschloß. MWG I/9.
7
Doch voll sichtbar wurde sie auch dort noch nicht, sondern, für die Zeitgenossen, erst im Kategorienaufsatz von 1913, Ebd.
8
für uns aber vor allem in den nachgelassenen Manuskripten, die Marianne Weber nach seinem Tod herausgab und die er von 1910 an niedergeschrieben hatte. MWG I/12.
9
MWG I/22 und 23.
Die in diesem Band versammelten Schriften, Diskussionsbeiträge und Stellungnahmen sind vornehmlich Gelegenheitstexte. Und dies gilt in einem wörtlichen Sinn. Sie sind für den Tag geschrieben, als politische, meist sozialpolitische Interventionen. Dies läßt sich selbst für den ‚Haupttext‘ des Bandes sagen, für die mit großem wissenschaftlichem, vor allem statistischem Apparat untermauerten agrarstatistischen und sozialpolitischen Betrachtungen zur Fideikommißfrage in Preußen.
10
Denn diese Betrachtungen sind durch die Veröffentlichung des „Vorläufigen Entwurfs eines Gesetzes über Familienfideikommisse nebst Begründung“ aus dem Jahre 1903 motiviert. Abdruck unten, S. 92–188.
11
[3]Mit diesem Gesetzentwurf sollte in Preußen das Fideikommißrecht vereinheitlicht und zugleich reformiert werden. Max Weber schrieb seinen großen Aufsatz, um auf die anstehende Reform Einfluß zu nehmen, um sie zu bekämpfen, indem er die voraussehbaren, für ihn sowohl sozial- wie staatspolitisch unerwünschten Folgen aufzeigte, die mit ihrer Verwirklichung verbunden sein würden. Daß er den wissenschaftlichen und statistischen Apparat für diesen durchaus polemischen Zweck schnell zusammenstellen konnte, verdankt sich nicht zuletzt der Tatsache, daß er hier Gedanken- und Tatsachenreihen wiederholte und weiterführte, die er bereits vor der Jahrhundertwende und vor der Krankheit entwickelt hatte. Vgl. dazu den Editorischen Bericht, unten, S. 81–91.
12
Gerade auch dieser Text setzt diese alte Entwicklungslinie fort. [3] Vgl. Max Webers in MWG I/3 und MWG I/4 vereinigte Arbeiten.
Der vorliegende Band versammelt also Texte von einer Art, wie wir sie von Max Weber aus der Zeit vor der Jahrhundertwende und vor der Krankheit kennen. Damals markierten sie die Hauptlinie seines Denkens, die aber nun, nach der Jahrhundertwende und nach der langsamen, freilich nie vollständigen Genesung, immer mehr zu einer Nebenlinie wird. Die andere Entwicklungslinie rückt in den Vordergrund. Weder verwirklichte Max Weber seinen Plan, eine größere Abhandlung über die Agrarverhältnisse in der Neuzeit, etwa aufbauend auf dem Vergleich zwischen Deutschland, Rußland, England und den USA, zu schreiben, wozu entscheidende ‚Vorarbeiten‘ in diesem Band enthalten sind,
13
noch verfolgte er seine Initiative für eine freiheitliche Sozialpolitik zwischen Laisser-faire-Liberalismus und Staatspatriarchalismus sowie Staatssozialismus mit letzter Konsequenz. Vgl. dazu die Formulierung unten, S. 134 f., wo Max Weber sagt, er wolle die Vorführung eines weit umfangreicheren Materials sich gerne „für eine künftige Erörterung dieser Dinge unter wissenschaftlich wertvolleren Gesichtspunkten als dem Augenblickszweck einer Gesetzgebungskritik vorbehalten“, und dann gehe es auch nicht mehr nur um Illustration, wie jetzt, sondern um Beweis.
Dennoch sind sie keineswegs von nur nebensächlichem Interesse. Zum einen zeigen sie in besonders prägnanter Weise, wie Max Weber seine sozialpolitischen Forderungen im Lichte sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse überprüfte, hier vor allem: im Lichte seiner Strukturanalyse des modernen Agrarkapitalismus; zum anderen geben sie in konziser Weise Auskunft über diese sozialpolitischen Forderungen selbst. Mehr noch: Gerade die Berichte über seine Reden und Diskussionsbeiträge, über die von ihm unterstützten Eingaben und Aufrufe für oder gegen Maßnahmen staatlicher oder kirchlicher Entscheidungsinstanzen verweisen auf seine weitergehenden politischen, vor allem verfassungspolitischen Ideale, aus denen schon früh die Forderung nach einer weiteren Parlamentarisierung der Reichsverfassung entsprang. Sie zeigen darüber hinaus Max Webers breitgefächer[4]tes Engagement in öffentlichen Angelegenheiten, so zum Beispiel für den Naturschutz, für die Frauenfrage oder für die internationale Verständigung. Hier wird eine Facette seiner Person sichtbar, die für manchen Leser sicherlich nicht nur neu, sondern auch überraschend ist. Deshalb lohnt es sich, die Texte unter drei Gesichtspunkten kurz zu betrachten: als Analyse der neuzeitlichen Agrarverfassung und ihres Wandels, als Plädoyer für eine freiheitliche Sozialpolitik zwischen Laisser-faire-Liberalismus und Staatspatriarchalismus sowie Staatssozialismus und als Aufforderung zu einer Weiterentwicklung der Reichsverfassung in Richtung auf eine parlamentarische Monarchie. Unter diesen drei Gesichtspunkten kann man in ihnen einen inneren Zusammenhang entdecken, wenngleich sie deshalb natürlich noch kein kohärentes Ganzes bilden, so wie man dies von anderen Teilen des Werkes sagen kann. Deshalb ist es nicht möglich und auch nicht nötig, den wissenschafts- und zeitgeschichtlichen Hintergrund übergreifend darzustellen. Was für die Einordnung und für das Verständnis der einzelnen Texte erforderlich ist, wird in den Editorischen Berichten mitgeteilt, die deshalb ausführlicher als üblich sind.
2. Die Agrarverhältnisse in der Neuzeit, insbesondere in Preußen
Beginnen wir mit dem ersten Gesichtspunkt, der Analyse der Agrarverhältnisse der Neuzeit, wie sie sich vor allem aufgrund des Eindringens der kapitalistischen Produktionsweise auch in die Landwirtschaft entwickelten und insbesondere in Preußen zu spezifischen sozialstrukturellen und kulturellen Verwerfungen führten. Die Erkenntnis der Eigenart sowie der Entstehungsbedingungen und Entwicklungstendenzen des preußischen Agrarkapitalismus und seiner Träger motivierte Max Weber bekanntlich schon früh dazu, für das sozialpolitische Programm einer „inneren Kolonisation“, einer „Bauernkolonisation“, im Osten Preußens einzutreten. Mit dessen Hilfe sollte auch dort ein leistungsfähiges deutsches Bauerntum auf großen und mittleren, nicht nur auf kleinen Stellen erzeugt werden, als Bollwerk gegen die ‚slavische‘ Einwanderung. Drei Texte gehen besonders darauf ein: die bereits erwähnten „Agrarstatistischen und sozialpolitischen Betrachtungen zur Fideikommißfrage in Preußen“, ein Vortrag in St. Louis, der nur in einer fragwürdigen englischen Übersetzung und unter dem Max Weber vermutlich auferlegten Titel „The Relations of the Rural Community to Other Branches of Social Science“ überliefert ist, und die aus einer Rezension entstandene Abhandlung „Die Kredit- und Agrarpolitik der preußischen Landschaften“. In allen drei Texten
14
geht es um Preußen, aber damit auch um [5]Deutschland, und zwar unter der doppelten Frage: Was wird unter den Bedingungen des ,im Sattel sitzenden‘ Kapitalismus aus der Freiheit der Deutschen und was aus der internationalen Machtstellung und Kulturbedeutung der deutschen Nation? [4] Abdrucke unten, S. 92–188, 212–243 sowie 333–355.
Bereits der Titel des ersten Aufsatzes, vermutlich im Frühjahr 1904 in großer Hast geschrieben, verweist auf zwei miteinander verbundene Aspekte: auf sozialwissenschaftliche Betrachtungen, die der Beschreibung und Analyse der Agrarverhältnisse Preußens als Teil der Sozial- und Staatsverhältnisse Deutschlands dienen, und auf sozialpolitische Betrachtungen, bei denen die Reform dieser Verhältnisse, eine Agrarpolitik für Preußen als Teil einer Sozial- und Staatspolitik für Deutschland, im Mittelpunkt steht. Unter dem ersten Aspekt begegnen wir Max Weber dem Sozialwissenschaftler, dem ausgewiesenen wissenschaftlichen Experten für die Agrarfrage, unter dem zweiten Max Weber dem Sozialpolitiker, dem stellungnehmenden Mitglied der bürgerlichen Klasse und der deutschen Nation. Letzterem ist die Sozialwissenschaft zwar das Medium, um die Durchführbarkeit sozialpolitischer Ideale zu prüfen, nicht aber die Instanz, um diese zu rechtfertigen. Das zweite verlangt den wertenden Menschen, dem die Freiheit des einzelnen wie die Machtgeltung und die Kulturentwicklung der Nation gleichermaßen am Herzen liegen sollten.
15
[5] Vgl. etwa unten, S. 272.
Nachdem Max Weber zunächst die Ziele und die wichtigsten Bestimmungen des Gesetzentwurfs dargestellt hat, eröffnet er seine sozialpolitische Intervention in der Fideikommißfrage mit „,theoretischen‘ Vorbemerkungen“.
16
Sie nennen die Gesichtspunkte, unter denen sich eine Agrarverfassung betrachten und beurteilen läßt. Unter dem Produktionsinteresse frage man danach, wie man auf gegebener Fläche möglichst viel erzeuge, unter dem Bevölkerungsinteresse danach, wie man auf gegebener Fläche möglichst viele Menschen beschäftige und dadurch ernähre, unter dem Verteilungsinteresse aber danach, wie eine gegebene Fläche möglichst umfassend und gleichmäßig zu verteilen sei. Das dritte sei der sozialpolitische Gesichtspunkt, unter dem er den Gesetzentwurf letztlich beurteilen wolle. Entscheidend aber sei nicht so sehr, welchem Gesichtspunkt und welchem Interesse man folge, sondern ob man sich im klaren darüber sei, daß zwischen ihnen grundsätzlich Konflikt besteht. Fördere man nämlich das Produktionsinteresse, insbesondere das Interesse an Getreideproduktion, und dies auch noch unter kapitalistischem Vorzeichen, so kollidiere dies sowohl mit dem Interesse an einer dichten und stabilen Landbevölkerung wie mit dem an einem leistungsfähigen und selbstbewußten Bauerntum. Man ergreife dann Partei für den Großgrundbesitz und unter Umständen auch für [6]den Großbetrieb, obgleich beide nicht notwendigerweise miteinander verbunden seien, kurz: man nehme in Kauf, daß sich das Land entvölkere und daß der ländliche Mittelstand, das Bauerntum, zerstört werde. Weber bringt diesen theoretisch begründeten Zusammenhang auf „eine möglichst einfache (und deshalb natürlich nur relativ gültige) Formel“, die da lautet: „Der bäuerliche Betrieb alten Schlages fragte: wie mache ich es, um möglichst viel Köpfe an Ort und Stelle auf der gegebenen Fläche durch ihre Arbeit zu ernähren? – der kapitalistische Betrieb fragt (das ist sein Begriffsmerkmal): wie mache ich es, um auf der gegebenen Fläche mit möglichster Ersparnis an unnötiger Arbeit ein möglichst großes Quantum Güter für den Absatz auf dem Markt disponibel zu machen?“ Unten, S. 115.
17
[6] Unten, S. 111 f.
Die einseitige Förderung des kapitalistischen Produktionsinteresses, insbesondere des „Getreide-Produktionsinteresses“,
18
hat also eine bevölkerungs- und verteilungs- bzw. sozialpolitisch unerwünschte Kehrseite: Die Bevölkerung nimmt ab und die Besitzkonzentration zu. Wird dieser so zusammengefaßte Boden gar im zentralistischen Großbetrieb wirtschaftlich genutzt, so verstärken sich diese Tendenzen. Dies gilt ganz allgemein, unabhängig von der Situation im Osten Preußens. Der Zusammenhang ist eine Art nationalökonomisches Gesetz, für die neuzeitliche Agrarverfassung gültig. In Preußen, insbesondere in seinen Ostprovinzen, seien solche Tendenzen, so Max Webers Diagnose, allerdings besonders stark ausgeprägt. Wer deshalb der Meinung sei – und Max Weber ist offensichtlich dieser Meinung –, es gelte, „soviel selbständige landwirtschaftliche Existenzen wie nur irgend möglich auf den dünn besiedelten, der Abwanderung und der Überschwemmung durch Ausländer oder doch Stammfremde preisgegebenen Boden des Ostens zu setzen“, der müsse „für den Osten die Beseitigung aller Institutionen verlangen, welche dem direkt entgegengesetzten Ziele zustreben, gleichviel, ob dadurch eine Schädigung der Produktionsinteressen – wie dies wenigstens für das Getreide wahrscheinlich ist – eintritt. Viele deutsche Landleute müssen ihm mehr wert sein als viel deutsches Korn.“ Unten, S. 117.
19
Unten, S. 113.
Warum aber sind diese Entwicklungen im Osten Preußens so weit gediehen? Und wäre das reformierte Familienfideikommiß eine Institution, die diese fördert oder hemmt? Dies sind die Fragen, die Max Weber an den Gesetzentwurf richtet und die zunächst noch unter seine sozialwissenschaftliche Betrachtung fallen. Welche Antworten gibt er darauf?
Bevor wir diese Antworten charakterisieren, sind noch Differenzierungen an dem theoretischen Modell anzubringen. Denn nicht der Großgrundbesitz [7]als solcher ist für den behaupteten Zusammenhang wichtig, sondern ob er frei oder gebunden ist und, wenn gebunden, ob es dabei in erster Linie um forstwirtschaftlich oder um landwirtschaftlich nutzbaren Boden geht. Beides nämlich beeinflußt das Angebot an handelbarer landwirtschaftlich nutzbarer Fläche und damit zumindest indirekt die Bodenpreise. Denn durch die umfassende fideikommissarische Bindung landwirtschaftlicher Flächen wird das Angebot an Boden, der sich gerade auch als Bauernland eignet, verknappt. Höhere Bodenpreise steigern die Besitzverschuldung bei ungebundenem Boden, weshalb dem Besitzer dann mitunter das Betriebskapital fehlt, um angemessene Erträge zu erzielen. Dies gilt gerade für die mittleren und größeren Bauernwirtschaften, weil sie sich beim Bodenkauf hoch verschulden müssen und deshalb nicht mehr kreditwürdig sind. Auch beim Großbetrieb muß man differenzieren. Der Großbetrieb wirkt nämlich unterschiedlich, je nachdem, ob der Bodenbesitzer selbst wirtschaftet oder wirtschaften läßt und, wenn er wirtschaften läßt, ob er einen Administrator einsetzt oder den Boden verpachtet. Er wirkt vor allem unterschiedlich, je nach der Höhe der Betriebsschulden und des Betriebskapitals. Es sind also nicht der Großgrundbesitz und der Großbetrieb als solche, für deren Wirkungen sich Max Weber interessiert, sondern der gebundene landwirtschaftliche Großgrundbesitz, der in Eigenregie großbetrieblich, d. h. letztlich: zentralistisch, genutzt wird. Von dieser Faktorenkonstellation allerdings, so Max Webers theoretisch begründete These, gehe jene Tendenz zur Entvölkerung des Landes und zur Zerstörung des Bauerntums, damit aber zur Polarisierung der ländlichen Sozialstruktur aus. Diese zeige sich darin, daß der Klasse der Großgrundbesitzer die Klasse des grundbesitzenden Proletariats gegenüberstehe, das Ganze ergänzt um eine Landarbeiterschaft, die überwiegend aus nicht seßhaften Saisonarbeitern bestehe. Denn die Akkumulation von Boden in den Händen weniger Agrarkapitalisten sei mit der Vermehrung der kleinen Stellen, der Stellen für Kleinstbauern oder für Parzellenpächter, durchaus verträglich, was allerdings deren Inhaber, wegen ihrer Seßhaftigkeit, der „Ausbeutung durch die Gutsherren“ wehrlos ausliefere.
20
Im übrigen begünstige diese Konstellation die Saisonarbeit in Gestalt der Wanderarbeit, also das rein kapitalistische Lohnverhältnis auch auf dem Land. Zudem entwickele sich unter solchen Bedingungen keinerlei Zwang zur betriebstechnisch rationalen Betriebsgröße und damit zur Dezentralisation der Betriebe sowie zu ihrer Übertragung an relativ autonome Wirtschaftsleiter, die landwirtschaftliche Fachkenntnisse besitzen. Die betriebswirtschaftliche Rationalität bleibe auf der Strecke, und weil dies so sei, werde von den Grundbesitzern versucht, suboptimale Betriebserträge mit [8]weiterer Bodenakkumulation zu kompensieren, was die beschriebene Polarisierung aber nur weiter vertiefe. [7] Unten, S. 143.
Die Agrarverfassung im Osten ist nach Max Weber tatsächlich dadurch gekennzeichnet, daß in ihr generell der Großgrundbesitz eine beherrschende Stellung einnimmt.
21
Ein Teil dieses Großgrundbesitzes aber ist fideikommissarisch gebunden – Max Weber spricht von etwa 1000 Besitzern und von einer Fläche von mehr als dem Umfang einer preußischen Provinz –, und zwar teilweise aufgrund von Vorgängen, die weit zurückreichen und bereits im Allgemeinen Landrecht von 1794 rechtlich normiert wurden, teilweise aufgrund von Lehensumwandlungen, teilweise aber aufgrund von Vorgängen, die erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts stattfanden. Vor allem diese spät entstandenen Fideikommisse – Max Weber nennt sie auch Parvenu-Fideikommisse –, die inzwischen in Preußen etwa die Hälfte aller Fideikommisse ausmachten, bewirkten sozialstrukturelle und kulturelle Verwerfungen. Sie vor allem hält er für sowohl sozial- wie staatspolitisch unerwünscht. [8] Unten, S. 151.
Max Weber unterscheidet also zwischen den alten und den neuen Fideikommissen. Letztere vor allem hätten zu jener schädlichen Verbindung von gebundenem Großgrundbesitz mit Großbetrieb bei Absorption der landwirtschaftlich besten Böden geführt. Mit dem Gesetzentwurf würde diese Fehlentwicklung nicht korrigiert, sondern weiter begünstigt. Würde er verwirklicht, so wäre endgültig ein „agrarisches Sonderrecht landsässiger Kapitalisten“ eingeführt.
22
Das Ziel, in Preußens Osten doch noch eine „,gesunde‘ soziale Verfassung des platten Landes“ zu erreichen, Unten, S. 104.
23
die kapitalistisch degenerierte Agrarverfassung zu reformieren, Unten, S. 170.
24
es nicht beim bloßen Nebeneinander von großen Bodenkomplexen und kleinen Stellen zu belassen, Unten, S. 136, bezogen auf Schlesien.
25
vielmehr die so dringend gebotene Bauernkolonisation voranzubringen, all dies würde mit der Verwirklichung des Gesetzentwurfs konterkariert. Unten, S. 128.
Max Weber wirft den Autoren des Gesetzentwurfs deshalb nicht nur theoretische Fehler vor, sondern auch die politische Absicht, die weitere Deformation der preußischen Agrarverfassung in Kauf zu nehmen, um die agrarische und konservative Parteiherrschaft in Preußen zu sichern.
26
Mehr noch: Er unterstellt den Autoren, „durch Gewährung einer Art ,Hoffähigkeit zweiter Klasse‘“, durch die „,Nobilitierung‘ von Kapitalien, die im Handel, in der Industrie, an der Börse erworben“ Unten, S. 173.
27
wurden, wollten sie Teile des städtischen [9]Bürgertums verführen, um dem Bürgertum insgesamt die politische Beteiligung weiterhin vorenthalten zu können. Was zunächst auf den Osten Preußens beschränkt scheint, strahlt so aus auf Deutschland als Ganzes. Die Fideikommißfrage betrifft nicht nur das preußische Bauerntum, sondern auch das deutsche Bürgertum. Unten, S. 170.
Nach Max Weber gilt es also zu erkennen, daß in der modernen Agrarverfassung Produktionsinteresse, Bevölkerungsinteresse und Verteilungsinteresse im Konflikt miteinander liegen und daß dieser Konflikt sich um so schärfer ausprägt, je tiefer die kapitalistische Produktionsweise die Landwirtschaft durchdringt. Die politische Reaktion darauf sollte nicht darin bestehen, daß man das Bevölkerungs- und das Verteilungsinteresse dem Produktionsinteresse opfert, also sein politisches Handeln ausschließlich am Kriterium kapitalistischer Rationalität ausrichtet. Vielmehr muß ein Ausgleich zwischen den drei Interessen gesucht werden, wie prekär auch immer, und es gilt alle Institutionen auf dem Lande daraufhin zu prüfen, ob sie diesem Ziel förderlich oder hinderlich sind. Sind sie ihm hinderlich, so müssen sie, wie bereits zitiert, beseitigt werden. Geht Max Weber in der Fideikommißfrage so weit, daß er für die Abschaffung des Instituts plädiert?
Dies ist interessanterweise nicht der Fall. Das Institut des Fideikommisses, richtig ausgestaltet, würde sich nämlich in seinen Augen mit der Fortentwicklung einer modernen Agrarverfassung und der Förderung einer gesunden Sozialverfassung auf dem Lande durchaus vertragen. Dies zeigten zunächst schon die großen und geschlossenen Fideikommißherrschaften, „bei denen der weit überwiegende Teil der landwirtschaftlich genutzten Fläche verpachtet, ein Teil des Rests administriert“ werde. Denn dies schaffe ,sturmfreie‘ Existenzen „mit der gesicherten Möglichkeit hoher Lebenshaltung und entwickelter geistiger und ästhetischer Kulturbedürfnisse, vor allem aber mit der Möglichkeit und dem Anreiz, auf landwirtschaftlichem Gebiet wirklich in großem Stile ökonomisch zu schalten.“
28
Solche Herrschaften fänden sich heute zwar in England, doch kaum mehr in Preußen, wo sie vielmehr weitgehend der Vergangenheit angehörten. Denn die preußischen Fideikommisse, ob alt oder neu, trügen heute nur noch sehr selten ,sturmfreie‘ Existenzen. Der altpreußische Junker, der Träger eines Intelligenzzentrums auf dem Lande und des staatspolitischen Interesses, sei weitgehend untergegangen, habe dem neupreußischen Agrarkapitalisten Platz gemacht. Wollte man den altpreußischen Junker unter veränderten Bedingungen wiederbeleben, so entstünden nur Zwittergestalten, Figuren, die weder echte ,Rückenbesitzer‘ noch echte landwirtschaftliche Unternehmer seien. Preußens Landwirtschaft kenne heute zwar Schnapsbrenner, Zuckersieder, Stärke- und Ziegelfabrikanten, Rüben- und Branntweinbarone, Klu[10]tenpetter, doch eben kaum mehr altpreußische Junker. Der Gesetzentwurf komme jenen Zwittergestalten entgegen, insbesondere ihren feudalen Prätentionen, indem er ihre Eitelkeits- und Prestigeinteressen befriedige. [9] Unten, S. 164.
Dennoch hätte das Institut in Max Webers Augen selbst für das Preußen der Gegenwart nicht allen Sinn verloren, würde man es unter äußerst restriktive Bedingungen stellen. Er entwickelt deshalb zehn Forderungen, die darauf zielen, das Institut den Agrarkapitalisten wieder zu entwinden und ihm seine staatspolitische Bedeutung zurückzugeben. Er ist sich freilich darüber im klaren, daß er damit politisch auf verlorenem Posten steht. Denn er will das Institut in erster Linie auf die verkehrsfernen und schlechten Böden beschränken und es von allen Eitelkeits- und Prestigeinteressen lösen. Man kann es auch anders sagen: Er will das Institut nicht nur den Agrarkapitalisten, sondern vor allem auch dem städtischen Bürgertum wieder entziehen. Denn seine wichtigsten Forderungen lauten: Weitgehende Beschränkung des Instituts auf Forstwirtschaft bei hohem Ertragsminimum und auf Familien, „die seit 100 Jahren adlig und seit ebenso langer Zeit, oder doch seit mehr als 2 Generationen im Besitz der größeren Hälfte des betreffenden Grundbesitzes“ sind. Außerdem will er die Stiftung eines Fideikommisses öffentlich machen: durch Bindung an die Zustimmung des Landtags. Schließlich verlangt er, daß jeder Zwang zu einer großbetrieblichen Bewirtschaftung des gebundenen Grundbesitzes beseitigt werde.
29
[10] Unten, S. 168–170, hier S. 167.
Auch ein anderes ,preußisches‘ Institut wird von Max Weber unter den genannten Gesichtspunkten kritisch unter die Lupe genommen: die „Landschaften“ als Immobilienkreditanstalten. Sie entstanden, wie das Fideikommiß, als ein Institut des adligen Grundbesitzes – Max Weber sagt, sie seien gegründet als „Standesinstitute des geldbedürftigen Adels“ –
30
und blieben, wie dieses, letztlich immer unter Staatsaufsicht. Doch, ähnlich wie das Fideikommiß, gelangte auch die „Landschaft“ während des 19. Jahrhunderts zunehmend in die Hände der Agrarkapitalisten und trug so zur kapitalistischen Degeneration der preußischen Agrarverfassung bei. Max Weber diskutiert deshalb die Wirkungen der Kreditpolitik dieser „Landschaften“ auf die preußische Agrarverfassung, insbesondere „1. auf die Verteilung des Bodens nach Besitzgrößen und 2. auf die innere Eigenart des landwirtschaftlichen Betriebes“. Unten, S. 334.
31
Unten, S. 333. Beide Gesichtspunkte sind die des unten, S. 333–355, rezensierten Buches von Hermann Mauer, Das landschaftliche Kreditwesen Preußens. Agrargeschichtlich und volkswirtschaftlich betrachtet. Ein Beitrag zur Geschichte der Bodenkreditpolitik des preußischen Staates (Abhandlungen aus dem Staatswissenschaftlichen Seminar zu Straßburg i.E., Heft 22). – Straßburg: Karl J. Trübner 1907, dem Max Weber deshalb mit großer Sympathie gegenübersteht.
[11]Der Landschaftskredit, gewissermaßen der Gegenpol zum Privatkredit, entstamme – so Max Webers Interpretation – ständischen Interessen, die er nie abgestreift habe. Und dies gelte, obgleich mit ihm von vornherein ein kapitalistisches Moment verbunden gewesen sei. „Die Landschaften und ihre Art der Kreditgewährung sind ein Produkt des seit dem 15. Jahrhundert stetig zunehmenden kapitalistischen Charakters der Gutswirtschaft des deutschen Ostens“
32
Sie hätten also immer schon den kapitalistischen Interessen des Großgrundbesitzes gedient. Die Entwicklungsgeschichte Deutschlands charakterisiere unter anderem, daß die moderne Hypothek in Verbindung mit der Grundschuld nicht, wie anderswo meist, ein städtisches Produkt sei, sondern ein Produkt des „städtearmen, getreideexportierenden Ostens“, jener frühen Stätte des deutschen Kapitalismus.[11] Unten, S. 338.
33
Und die Wahrung dieser ständischen Interessen habe auch angedauert, als man im 19. Jahrhundert, nach der Bauernbefreiung, Landschaftskredite für Bauernbesitzungen vergab. Denn dies habe letztlich nur dazu gedient, die Bauern ökonomisch an „das bedrohte politische Herrschaftsinteresse des Großgrundbesitzes“ zu fesseln. Ebd.
34
Der Landschaftskredit habe also in seiner Geschichte nie dem freien Bauerntum, sondern stets nur dem Großgrundbesitz genützt. Unten, S. 336.
Wiederum ist die Stoßrichtung von Max Webers Analyse deutlich: Auch die „Landschaft“, obgleich zunächst ganz ,modern‘, sei wie das Fideikommiß eine Institution, die die Bodenzusammenballung und damit den Großgrundbesitz sowie seine Bewirtschaftung in Großbetrieben begünstige. Damit aber stehe sie der Ausbildung einer ,gesunden‘ Sozialverfassung auf dem Lande im Weg. Beide Institutionen, Fideikommiß und „Landschaft“, hätten sich letztlich als bauernfeindlich erwiesen, in der Vergangenheit ebenso wie in der Gegenwart. Wie Preußens Agrarpolitik insgesamt, so habe auch seine Kreditpolitik letztlich immer die Klasseninteressen des Großgrundbesitzes geschützt und die Entwicklung eines freien Bauerntums im Osten verhindert, obgleich dessen Existenz gerade hier von herausragendem staats- und nationalpolitischem Interesse sei.
Freilich zeigt sich die Eigenart des preußischen Agrarkapitalismus für Max Weber nur bedingt in entwicklungsgeschichtlicher Betrachtung. Denn für die Gutsherrschaft im deutschen Osten ist ja von Beginn an bezeichnend, daß sie den Keim des Kapitalismus in sich trägt. Will man diese Eigenart besonders anschaulich machen, so sollte man dafür die vergleichende Betrachtung wählen. Als Vergleichsobjekte bieten sich die Agrar[12]verfassungen des deutschen Westens und Südens sowie Englands an.
35
Mit diesen Vergleichen nämlich läßt sich verdeutlichen, daß das Eindringen der kapitalistischen Produktionsweise in die Landwirtschaft keineswegs das Land entvölkern und das freie Bauerntum zerstören muß (deutscher Westen und Süden). Ferner läßt sich mit ihnen zeigen, daß der Großgrundbesitz nicht zwingend die betriebswirtschaftliche Rationalität mindert, weil man Großgrundbesitz und Betrieb trennen kann (England). [12] Interessant wäre auch der Vergleich mit der Antike. Vgl. dazu Schluchter, Wolfgang, Rationalismus der Weltbeherrschung. – Frankfurt a.Μ.: Suhrkamp 1980, Kap. 4.
Betrachten wir zunächst den Vergleich des deutschen Ostens mit dem deutschen Westen und Süden. Max Weber stellt ihn immer wieder in seinen agrargeschichtlichen Studien an. Er konstatiert erhebliche strukturelle Unterschiede. In dieser Sichtweise gewonnene Ergebnisse trug schon früh sehr einprägsam unter anderen auch Georg von Below vor. Unter dem Titel Territorium und Stadt veröffentlichte dieser im Jahre 1900 gesammelte Aufsätze zur deutschen Verfassungs-, Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte. Er eröffnet diese Aufsatzsammlung mit der Feststellung, seit dem 16. Jahrhundert bestehe ein struktureller Unterschied zwischen der deutschen Agrarverfassung im Osten und im Westen: „Hier finden wir die Grund-, dort die Gutsherrschaft. Im Westen wird der Boden im kleinen, im Osten im großen Betrieb genutzt.“
36
Bei der Grundherrschaft werde eine Hofländerei von der Größe eines Bauernbetriebs vom Grundherrn bewirtschaftet, daneben stünden aber viele Bauerngüter, die ihm abgabepflichtig seien. Es existierten relativ autonome Gemeinden, die Jurisdiktionen mehrerer Herren über ein Gebiet überschnitten sich. Bei der Gutsherrschaft dagegen falle die Hofländerei weitgehend mit dem Betrieb insgesamt zusammen, die Bauern würden zu Frondiensten (Hand- und Spanndiensten) herangezogen, die Gemeinde zum dienenden Glied der Gutsherrschaft gemacht. Der Gutsherr sei der einzige Herr über ein Gebiet, halte die richterliche und die polizeiliche Gewalt in Händen. Er mediatisiere auf diese Weise auch den Landesherrn. Dies sei im Westen anders. Hier komme es zu dem Dreiecksverhältnis Landesherr, Grundherr und freier Bauer. Diese Konstellation aber sei mit ursächlich dafür, daß es im Westen keine Bodenzusammenballungen größeren Ausmaßes gegeben habe, weil es zwischen den drei Trägern zu einer Dauerkonkurrenz ohne endgültigen Sieg des einen über den anderen gekommen sei. Below, Georg von, Territorium und Stadt. Aufsätze zur deutschen Verfassungs-, Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte. – München/Leipzig: R. Oldenbourg 1900, S. 1.
Nach von Below existierte dieser Unterschied zwischen Ost und West noch nicht im 12. und 13. Jahrhundert.
37
Er fragt deshalb, worauf er zurückzuführen sei. Er nennt die unterschiedliche Rolle von Staatsgewalt und [13]Staatsdienst in Ost und West, die Bedeutung der Weistümer im Westen, die im Osten fehlten, vor allem aber die Geschichte der Kolonisierung im Osten, die zu einer größeren räumlichen Isolierung der Güter, zu ihrer geringeren Verflechtung in den Markt, aber auch zu Besitzkonzentration, also zur Vermeidung von Streubesitz zwang. Die Hofländereien seien also von Beginn an groß und die Staatsgewalt fern gewesen. Im Osten habe schon immer eine ausgeprägte Tendenz zum Großgrundbesitz in Verbindung mit dem landwirtschaftlichen Großbetrieb und mit dem Interesse an erbuntertänigen Bauern existiert. Diese Tendenz habe sich im Laufe der Jahrhunderte nur immer stärker ausgeprägt und so den Osten immer deutlicher vom Westen ,getrennt‘. Ebd., S. 9.
Max Weber sieht dies genauso. Doch gibt es nicht nur diese interessante strukturelle Differenz. Blickt man nach England, so erkennt man eine weitere. An England nämlich lasse sich studieren, so Max Weber, daß sich Großgrundbesitz und betriebswirtschaftliche Rationalität keineswegs ausschlössen. Freilich setze dies voraus, daß man Besitz und Betrieb, Rente und Profit strikt trenne und sie auf zwei Träger, auf Landlord und Pächter, verteile. Dies habe auch den Vorteil, daß man auf ökonomische Krisen mit größerer Elastizität reagieren könne.
38
In Preußen, so Max Webers Diagnose, fehle diese, weil die Trennung fehle. Hier bleibe der Großgrundbesitz auf unheilvolle Weise mit dem Großbetrieb in Eigenregie verquickt. Hier fordere man deshalb den Schutzzoll als Schutzwall gegen die Gefährdungen durch den Weltmarkt – auf Kosten der betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen ökonomischen Rationalität sowie auf Kosten der Sicherung der Ostgrenze gegen Unterwanderung. [13] Unten, S. 164.
Max Weber entwickelt diese vergleichende Betrachtung vor allem in seinem Vortrag in St. Louis,
39
in dem er unter anderem auf von Below zustimmend eingeht. Doch hier will er darüber hinaus zeigen, daß die Ausgangspunkte der kontinentalen und der amerikanischen Agrarentwicklung gänzlich andere waren und daß deshalb auch die Folgen des Agrarkapitalismus andere sind. In den USA hätten sich auch auf dem Lande Kapitalismus und Individualismus, zumindest nach dem Bürgerkrieg, erfolgreich durchsetzen können. Auf dem Kontinent dagegen gebe es überall historische Erbschaften, die einer freien Entfaltung von Kapitalismus und Individualismus auf dem Lande hinderlich waren. Nur in England sei dies anders. Es repräsentiere den europäischen Sonderfall. Die Agrarverfassung der USA (auch die Englands) kenne deshalb die Sozialfigur des Farmers, der, sei es als Eigner, sei es als Pächter, als reiner Unternehmer und Geschäftsmann agiere. Er sei [14]also kein Bauer im kontinentalen Sinn. Abdruck unten, S. 212–243.
40
Diese für die kontinentale Agrarverfassung so wichtige Sozialfigur aber drohe unter dem Ansturm des Kapitalismus auf das Land zu zerfallen. Denn der Bauer könne nicht länger Bauer bleiben und dennoch nicht landwirtschaftlicher Unternehmer werden, weil der Boden zu knapp sei und der Bodenpreis häufig unerschwinglich hoch.[14] Im übrigen wiederholt Max Weber Argumente, die wir aus der Abhandlung über die Fideikommißfrage kennen, teilweise wörtlich. Vgl. unten, S. 213–215.
41
Was für die Sozialfigur des europäischen Bauern gelte, gelte cum grano salis auch für die Sozialfigur des europäischen Landaristokraten. Auch er könne nicht länger Landaristokrat bleiben, wolle aber auch nicht einfach Agrarkapitalist werden. Dazu fehle ihm außerdem die unternehmerische Kompetenz. Überall auf dem alten Kontinent entstünden daher Zwittergestalten. Amerika scheint es in dieser Hinsicht in Max Webers Augen also besser zu haben, wenngleich er prognostiziert, daß mit dem Ende der Landnahme und der Verknappung des wirtschaftlich verwertbaren Bodens auch hier die Schließung sozialer Beziehungen auf dem Lande drohe. Vgl. unten, S. 219.
42
Vgl. etwa die Passage unten, S. 217.
Max Weber diskutiert also zunächst die Wirkungen unterschiedlicher Agrarverfassungen bei eindringender kapitalistischer Produktionsweise. Was aber sind seine sozialpolitischen Ideale, an denen er diese Wirkungen mißt? Wo hört der Mann der Wissenschaft zu sprechen auf, und wo beginnt der stellungnehmende Mensch, der sich aufgerufen fühlt, Werturteile zu fällen? Es ist keine Frage, daß insbesondere der III. Abschnitt seiner Kritik am Entwurf des Fideikommißgesetzes
43
voller Werturteile steckt. Sie richten sich zwar auch auf die konservative preußische Politik, vor allem aber auf das schwächliche und anpassungswillige deutsche Bürgertum. Statt den Industriestaat bewußt zu wollen und seine Möglichkeiten offensiv zu nutzen, suche es „Boden als Rentenfonds zu Nobilitierungszwecken aufzuhäufen“, um sich dann in der „Gnade des Hofes zu sonnen“. Und dies nicht nur auf Kosten der eigenen ökonomischen und politischen Interessen, sondern auch auf Kosten einer „zahlreichen und kräftigen Bauernbevölkerung“. Unten, S. 172–188.
44
Mehr noch: Statt sich dem offenen Weltmarkt auszusetzen, begebe man sich in den Schutz der Zölle. Statt Konkurrenz Protektionismus, statt bürgerlicher Charakterbildung durch „ökonomische Eroberungen in der weiten Welt“ die Sehnsucht nach der pseudofeudalen Rentierexistenz. Unten, S. 187 f.
45
Unten, S. 185.
Sind dies bloße Beschimpfungen eines bürgerlichen Intellektuellen, oder stecken dahinter formulierbare sozial- und staatspolitische Ideale? Was reguliert Max Webers Polemik über die wissenschaftlich informierte Folgen[15]abschätzung hinaus? Dies führt uns zum zweiten und dritten Gesichtspunkt, zu Max Webers sozial- bzw. staatspolitischer Wertposition.
3. Freiheitliche Sozialpolitik zwischen Laisser-faire-Liberalismus und Staatspatriarchalismus sowie Staatssozialismus
Spätestens mit der Reichsgründung wurde in Max Webers Sicht auch in Deutschland der Schritt vom Agrarstaat zum Industriestaat und vom Kulturstaat zum Machtstaat irreversibel vollzogen.
46
Dies sei ein Faktum, das die Sozialpolitik nicht ignorieren dürfe. Es könne nicht länger um die Interessen der Grundaristokratie gehen, sondern es müßten die Interessen des Bürgertums, der Arbeiterschaft und der Bauernschaft unter den Bedingungen wachsender Weltmarktverflechtung in den Mittelpunkt treten. Man könnte auch sagen: Es geht um die Autonomie und die Selbstorganisation der bürgerlichen Gesellschaft, ein Begriff, den Max Weber zwar nicht in seinem wissenschaftlichen Werk, wohl aber bei seinen Debattenreden im Verein für Sozialpolitik häufiger benutzt.[15] Vgl. etwa seine Diskussionsbeiträge auf dem Evangelisch-sozialen Kongreß 1897 in Leipzig zum Vortrag von Karl Oldenberg: „Über Deutschland als Industriestaat“, in: MWG I/4, S. 626–640. Für Max Weber ist Deutschland keine ökonomische Einheit. Es sei vielmehr „zusammengeschweißt aus zwei von einander wesentlich verschiedenen wirtschaftlichen Gebieten, von denen das eine nach Westen, das andere nach Osten blickt, das eine längst ,Industriestaat‘ ist, das andere bisher ,Agrarstaat‘ blieb; und das fundamentale Problem unserer ganzen nationalen Wirtschaftspolitik liegt in dem unausgeglichenen Verhältnis dieser beiden, ungefähr an der Elbe und untern Weser sich von einander scheidenden Hälften, welche politisch zusammengehören, ökonomisch aber auseinanderstreben.“ Ebd., S. 635
47
Neben der ökonomischen Verflechtung in den Weltmarkt aber stehe die politische und kulturelle Verflechtung in ein von Kultur- und Machtstaaten geprägtes Europa. Einer der Wertgesichtspunkte, die Max Webers sozialpolitische Interventionen leiten, ist die ökonomische, politische und kulturelle Selbstbehauptung der deutschen Nation. Vgl. etwa unten, S. 308 f.
Sozialpolitik hat also zunächst diesem Anspruch auf Selbstbehauptung unter industriestaatlichen Bedingungen zu dienen. Doch ist dies nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist: Solche Selbstbehauptung verlangt politische Freiheit im Innern, die in individueller Freiheit fundiert sein muß.
48
Nur ein freies Bürgertum, eine freie Arbeiterschaft und ein freies Bauerntum können diese Selbstbehauptung letztlich tragen, gesellschaftliche Kräfte also, die nicht länger bloßes Objekt der Staatskunst bleiben dürfen, sondern die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen müssen, mit Blick für die [16]eigenen Interessen, aber auch für das sachlich Gebotene. Nicht Schein der Macht, sondern reale Macht, nicht Eitelkeits- und Prestigeinteressen, sondern sachliche Interessen müssen ihr Handeln bestimmen. Dazu bedarf es eines institutionellen Rahmens, der solche sachliche Politik, eine Politik der rationalen Interessenvertretung und des rationalen Interessenausgleichs nach innen und nach außen, zu stützen vermag. Denn ohne kollektive und individuelle Freiheit im Innern gibt es für Max Weber zu seiner Zeit keine Macht- und Kulturgeltung der Nation nach außen. Beide setzen sich wechselseitig voraus. Unten, S. 314.
Sozialpolitik hat deshalb für Max Weber die Aufgabe, rationale Interessenpolitik zu ermöglichen, indem sie die Verteilungsfragen so löst, daß auf eigenen Füßen stehende kollektive Akteure entstehen können. Sie müssen ihre Interessen erkennen und sich selbst organisieren, und zwar so, daß dabei das staatliche und nationale Interesse, das Gemeinwohl, nicht aus dem Blick gerät. Dies ist das sozialpolitische Credo, das insbesondere in seinen Debattenreden im Verein für Sozialpolitik zum Ausdruck kommt.
Prüft man die sozialpolitische Diskussion der Zeit, so lassen sich drei Positionen in idealtypischer Zuspitzung unterscheiden:
49
Die einen wollen Sozialpolitik auf Wirtschaftspolitik reduzieren und diese soweit als möglich entstaatlichen; die anderen unterscheiden zwar Aufgaben der Sozialpolitik von denen der Wirtschaftspolitik, erheben beide aber zu Aufgaben des Staates; und wieder andere unterscheiden gleichfalls zwischen den beiden Aufgaben, wollen die Sozialpolitik aber weitgehend einer selbstorganisierten Gesellschaft überlassen. Die ersten vertreten einen Laisser-faire-Liberalismus, die zweiten einen Staatspatriarchalismus, die dritten aber eine freiheitliche Sozialpolitik. Dieser Richtung rechnet sich Max Weber zu. [16] Dazu ausführlich MWG I/3, Einleitung.
Die erste Position wurde vor allem außerhalb des Vereins für Sozialpolitik entwickelt, die beiden anderen darin, und zwar, je länger je mehr, in scharfer Konkurrenz. In gewissem Sinn spiegelt sich darin ein Generationsphänomen. Der Generation, die den Verein für Sozialpolitik gegründet hatte, zwar durchaus in Opposition zu Bismarck, aber doch nicht unbeeinflußt von seinem Geist, standen jene ,Nachgeborenen‘ gegenüber, die gegen ein autoritäres Verständnis von Sozialpolitik aufbegehrten. Prägnant kommt dies in einer Debattenrede Max Webers zum Ausdruck: Obgleich die Gründergeneration einst zu Recht gegen „jene Beifallssalve für die rein technologischen Leistungen der industriellen Mechanisierung, wie sie die manchesterliche Lehre damals darstellte“, gekämpft habe, stehe sie heute in der Gefahr, selbst „eine ebensolche Beifallssalve für das Maschinenwesen auf dem Gebiet der Verwaltung und der Politik“ abzugeben,
50
weil man „an [17]die Allmacht des von niemand bezweifelten hohen moralischen Standards gerade unseres deutschen Beamtentums“ glaube. Unten, S. 365.
51
Damit aber stelle man letztlich die bürokratische Betreuung der Bevölkerung durch den Staat höher als den freien Zusammenschluß und die freie Interessenverfolgung der Beteiligten. Gegen dieses autoritäre Verständnis von Sozialpolitik wandten sich viele der Jüngeren. Max Weber sagt deshalb auch „wir anders Denkenden“.[17] Unten, S. 361 f.
52
Man hat diese unterschiedlichen Grundorientierungen immer wieder auf den Gegensatz rechts-links bringen wollen. Und dies nicht ohne Grund. Auch Max Weber benutzt gelegentlich selbst den Begriff der ,sozialpolitischen Linken‘. Dennoch trifft diese Unterscheidung den beschriebenen Sachverhalt nur sehr bedingt. Eher geht es um eine unterschiedliche Auslegung derselben Ziele, wie auch „Kirchen“ und „Sekten“ das Evangelium verschieden leben. In Analogie dazu ließe sich formulieren: Die ältere Generation sah Sozialpolitik aus dem Blickwinkel eines kirchenähnlichen Patriarchalismus, die Jüngeren aus dem eines sektenähnlichen Voluntarismus. Beide Richtungen sind sich in ihrer Gegnerschaft zu einem Laisser-faire-Liberalismus mit seinem Besitzindividualismus einig. Aber sie messen der kollektiven und individuellen Freiheit für die Sozialpolitik unterschiedliche Bedeutung bei. Für einen freiheitlichen Sozialpolitiker kommt es entscheidend darauf an, daß die wichtigsten gesellschaftlichen Kräfte in den Stand gesetzt werden, die eigenen Interessen zu formulieren und sie frei und offen zu verfolgen, freilich, ohne dabei die staatlichen und nationalen Interessen gänzlich außer acht zu lassen. Kurz: Er will mithelfen, daß unabhängige, unbefangene, Max Weber sagt auch: männliche, freie Bürger entstehen. Unten, S. 361.
Das Gegenbild einer freiheitlichen Sozialpolitik ist also nicht nur der Besitzindividualismus des Laisser-faire-Liberalismus, sondern auch der Autoritarismus des Staatspatriarchalismus sowie des Staatssozialismus, weil der erste ausschließlich auf den egoistischen Individualisten, der zweite aber auf den Ordnungsmenschen zielt. Im Unterschied dazu orientiert sich die freiheitliche Sozialpolitik am Bild des freien Bürgers, der, weder von Ohnmachts- und Angstgefühlen besessen noch von Eitelkeits- und Prestigeinteressen getrieben, ein selbstbestimmtes und selbstbewußtes Leben führt. Man könnte ihn einen moralischen Individualisten nennen.
53
Institutionen müssen deshalb immer auch daraufhin befragt werden, was sie „charakterologisch“ aus dem Menschen machen, Dazu Schluchter, Wolfgang, Unversöhnte Moderne. – Frankfurt a.Μ.: Suhrkamp 1996, Kap. 8.
54
ob sie seine Erziehung zum egoi[18]stischen Individualisten, zum Ordnungsmenschen oder zum freien Bürger begünstigen. Mehr noch als der egoistische Individualist, der seine individuelle Freiheit schätzt und seine Interessen rational kalkuliert, ist Max Weber der Ordnungsmensch zuwider. Deshalb polemisiert er bei seinen sozialpolitischen Interventionen vor allem gegen jede institutionelle Beschränkung von individueller und kollektiver Freiheit, also gegen Verstaatlichung, Kommunalisierung, Kartellierung und Syndizierung, kurz: gegen Bürokratisierung, weil dies die Sozialfigur des Ordnungsmenschen erzeugt. Aber er wendet sich auch gegen die Zwangsvereinigung derjenigen, denen gemeinsame Interessen unterstellt werden, etwa gegen die Zwangsvereinigung der Arbeiter in Gewerkschaften, obgleich er diesen durchaus einen Eigenwert zuspricht, nicht zuletzt deshalb, weil er ihnen für die Erziehung der Arbeiter mehr zutraut als der Sozialdemokratie. Unten, S. 251. Auch dies ist für Weber ein „entscheidender Wertgesichtspunkt“.
55
Statt nach Zwangsvereinigung zu rufen, sollte man – so Max Weber – die Fähigkeit zur Selbstorganisation, also die Koalitions- und Organisationsfreiheit, stärken, vor allem aber darauf achten, daß bei Verteilungskämpfen Waffengleichheit der Parteien besteht. Dies gelte ganz besonders für die industriellen Beziehungen: Tarifverträge dürften keine Unterwerfungsverträge sein. Ein Gemeinwesen, das sich zu einer freiheitlichen Sozialpolitik bekennt, dürfe auch keiner Arbeitgebergesinnung huldigen: „Nur ein von Arbeitgebergesinnung freies Gemeinwesen“ könne auf Dauer ein Hort von Sozialpolitik sein.[18] Unten, S. 259.
56
Immer wieder entzündete sich der Konflikt zwischen der älteren und der jüngeren Generation im Verein für Sozialpolitik an solchen Fragen. Die in diesem Band abgedruckten Diskussionsbeiträge Max Webers auf dessen Tagungen legen davon beredt Zeugnis ab. Unten, S. 365.
Max Webers sozialpolitische Position wird auch aus jenem Entwurf eines Einladungsschreibens für eine sozialpolitische Aussprache aus dem Jahre 1912 sichtbar,
57
mit dem er noch einmal Gleichgesinnte für eine Erneuerung der sozialpolitischen Diskussion gewinnen wollte. Hier ist seine freiheitliche Sozialpolitik, man könnte auch sagen: sein sozial gefärbter Liberalismus, Abdruck unten, S. 375–377.
58
besonders prägnant formuliert. Der Initiative war kein Erfolg beschieden. Nicht einmal die vorgeschlagene vertrauliche Aussprache unter Gleichgesinnten kam zustande, nachdem man bereits auf die ursprünglich vorgesehene Kundgebung verzichtet hatte. Unten, S. 277.
59
Vgl. dazu die entsprechenden Briefe in MWG II/7.
Dieser Entwurf ist in zwei Hinsichten von Interesse. Zum einen zeigt seine Vorgeschichte, daß Max Weber auf eine in spezifischem Sinne bürgerliche [19]freiheitliche Sozialpolitik setzte, zum anderen, daß er sauber zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitik trennen wollte. Das brachte ihn zu Lujo Brentano, einem der wenigen Vertreter einer freiheitlichen Sozialpolitik aus der älteren Generation des Vereins für Sozialpolitik, in eine keineswegs harmlose persönliche und politische Spannung.
60
Weder wollte Max Weber wie Lujo Brentano die Zollpolitik erörtert sehen – eine wirtschaftspolitische Frage –, noch wollte er die Sozialdemokratie mit ins Boot nehmen – eine Frage des bürgerlichen Selbstverständnisses. Denn es ging ja auch um die Grundsatzfrage: Voluntarismus oder Staatssozialismus. Und es kann kaum zweifelhaft sein, daß dies aus seiner Sicht als Voluntarismus gegen Staatssozialismus zu lesen war. Die ältere Generation nicht nur des Vereins für Sozialpolitik, sondern auch der Sozialdemokratie blieb eben in einem autoritären Verständnis von Sozialpolitik gefangen. Immer wieder hatte Max Weber ja gegen die ,unheilige Allianz‘ von Agrarkapitalismus, Syndikalismus und Sozialdemokratie gewettert, weil diese, wenn auch aus gänzlich unterschiedlichen Motiven, einer freiheitlichen Sozialpolitik letztlich ablehnend gegenüberstanden. [19] Dazu Editorischer Bericht, unten, S. 367–370.
Und noch in einer dritten Hinsicht ist der Entwurf von Interesse. Für Max Weber hatte sich die sozialpolitische Ausgangslage über die Jahre verändert. Die von der älteren Generation des Vereins für Sozialpolitik so begrüßte Verstaatlichung, Kommunalisierung, Kartellierung und Syndizierung des Wirtschaftslebens, die „unaufhaltsame Bürokratisierung der Bedarfsversorgung“,
61
war tatsächlich eingetreten. Das konnte nicht ohne Folgen für die Lage der Arbeiterschaft, überhaupt für die Lage der breiten Massen sein. Darauf galt es mit Neuregelungen zu reagieren, vor allem beim Arbeitsvertrags- und beim Beamtenrecht. Ziel mußte es sein, die freie Arbeit zu schützen, in der Stadt, aber auch auf dem Lande. Nicht zufällig nennt er in diesem Zusammenhang die „drohende Verfälschung der Ziele der inneren Kolonisation und auch die Gefahren der gegenwärtigen Agrarkreditpolitik.“ Unten, S. 375.
62
Unten, S. 376.
Nun steht natürlich auch eine freiheitliche Sozialpolitik à la Weber nicht isoliert da. Sie hat Beziehungen zur Wirtschaftspolitik einerseits, zur Staats- als Verfassungspolitik andererseits. Denn nicht nur die agrarischen und die industriellen, auch die politischen Institutionen entfalten eine erzieherische Wirkung. Auch sie haben ,charakterologische‘ Folgen, die von Bedeutung sind. Dies führt uns zu unserem dritten und letzten Gesichtspunkt. Wie sehen Max Webers Wertgesichtspunkte in der Verfassungsfrage aus?
[20]4. Der parlamentarische Staat als parlamentarische Monarchie
Max Weber läßt keinen Zweifel daran, daß er das Kaiserreich als scheinkonstitutionell einstuft. Anders als England ist Deutschland kein parlamentarischer Staat in Gestalt einer parlamentarischen Monarchie. Die parlamentarischen Institutionen sind machtlos. Die politische Verfassung insgesamt sei, wie auch die Agrar- und Industrieverfassung, autoritär verformt. Das Institutionengefüge insgesamt diene nicht dem Ideal der Freiheit. Es favorisiere nicht den freien Bürger, sondern den Ordnungsmenschen. Überall herrsche das Gefühl des „Reglementiert-, Kommandiert- und Eingeengtseins“,
63
nicht nur beim Militär, sondern auch im Parlament, in der Behörde und in der Fabrik. [20] Unten, S. 253.
Dennoch sind für Max Weber die parlamentarischen Institutionen nicht überflüssig. So verteidigt er zunächst einmal die Reichsverfassung gegen ,Bedrohung‘, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil durch sie nicht allein die Einheit des Reiches gewährleistet werde, sondern auch ein Minimum an Parlamentarismus. Schon aus seiner ersten öffentlichen verfassungspolitischen Intervention nach der Krankheit aus dem Jahre 1904 wird dies klar.
64
Andere Äußerungen machen darüber hinaus deutlich, daß er die parlamentarischen Institutionen nicht nur erhalten, sondern gestärkt und in ihren Kompetenzen erweitert sehen will. Unten, S. 76–80.
65
Vorbild ist ihm dabei offensichtlich das parlamentarisch regierte monarchische England. Ähnlich wie in der Agrarfrage, hat England auch in der Staatsfrage für Max Weber den richtigen Schritt aus der Vergangenheit in die Gegenwart getan. Vgl. unten, S. 392–397.
Max Weber zeigt sich auch kompromißlos in der Wahlrechtsfrage. Das Plural- und Klassenwahlrecht hat für ihn ein für allemal ausgedient.
66
Der auch für Deutschland überfällige Schritt zum parlamentarischen Staat verlange, daß man auf allen Ebenen und in allen Staaten das allgemeine gleiche Wahlrecht einführe. Eine Alternative dazu gibt es für ihn nicht mehr. Unten, S. 306 f.
Kapitalismus und Parlamentarismus – dies sind die Mächte der Zukunft. Doch sie prägen bereits die Gegenwart. Auch in Deutschland haben sie Eingang gefunden, aber es sperrt sich gegen die damit verbundenen Folgen, will nicht endgültig Abschied nehmen vom Agrarstaat und vom persönlichen Regiment. So produziert es Zwittergebilde, einen ständischen Kapitalismus und einen Scheinkonstitutionalismus. Beide untergraben Deutschlands Machtgeltung und Kulturbedeutung in der Welt.
[21]Bei Max Weber hängen also seine Strukturanalysen der Agrar-, Industrie- und Staatsverfassung Deutschlands und seine sozial- und staatspolitischen Ideale aufs engste zusammen. Deutschland ist auf dem Weg zu Kapitalismus und Parlamentarismus steckengeblieben, überall verfängt es sich in den Fesseln seiner Vergangenheit. In einer seiner Debattenreden im Verein für Sozialpolitik zitiert er Goethe mit der Reflexion: „Wir alle leben vom Vergangenen und gehen am Vergangenen zu grunde“.
67
Das ist dort auf Gustav Schmollers Bürokratiestudien gemünzt. Aber diese Reflexion läßt sich auch auf Max Webers Verhältnis zu seinem Deutschland anwenden. Es ist ein ambivalentes Verhältnis, weil Deutschland nicht nur aus der Vergangenheit lebt, sondern auch an dieser Vergangenheit zugrunde zu gehen droht. [21] Unten, S. 372.