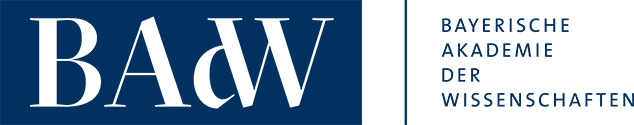[92]Zur Edition dieses Bandes
I. Zur Textüberlieferung
Der vorliegende Band umfaßt hauptsächlich Max Webers nachgelassene Texte zum Thema „Herrschaft“, die im Kontext seines „Grundriß“-Beitrages „Wirtschaft und Gesellschaft“ entstanden sind und postum als dritter und letzter Teil der von Marianne Weber und Melchior Palyi besorgten Ausgabe zum Abdruck gelangt sind.
1
Sie bildeten dort den Hauptbestand der vierten Lieferung des Werkes, die vom Verlag J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) am 20. September 1922, kurz vor Beginn des Dritten Deutschen Soziologentages, ausgeliefert wurde.[92] Weber, Max, Wirtschaft und Gesellschaft (Grundriß der Sozialökonomik, Abt. III, 4. Lieferung), 1. Aufl. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1922, S. 603–612, 642–817.
2
Zwischen dem Tod Max Webers und dem Erscheinen der „Herrschaftssoziologie“ lagen somit weit über zwei Jahre. Dem hier vorliegenden Band sind außerdem der von Marianne Weber postum publizierte Text „Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft“ sowie ein Zeitungsbericht über Max Webers Vortrag „Probleme der Staatssoziologie“ beigefügt. Der Soziologentag fand am 24. und 25. September 1922 in Jena statt und war in der Korrespondenz zwischen Marianne Weber und dem Verlag seit Anfang August 1922 ein anvisiertes Datum für das Erscheinen der vierten Lieferung. Vgl. den Brief von Oskar Siebeck an Marianne Weber vom 7. Aug. 1922, VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446. Den Versand der ersten gedruckten Bände kündigte Werner Siebeck am 20. September 1922 in seinem Brief an Marianne Weber an (ebd.).
3
Der 12-seitige Aufsatz über die „drei reinen Typen“ fand sich ebenfalls im Nachlaß Max Webers, aber – wie Marianne Weber Jahrzehnte später gegenüber Johannes Winckelmann angab – nicht im Konvolut zu „Wirtschaft und Gesellschaft“. Weber, Die drei reinen Typen, unten, S. 717–742, und Weber, Probleme der Staatssoziologie, unten, S. 745–756.
4
Er wurde von ihr vor dem Erscheinen der „Herrschaftssoziologie“ in den „Preußischen Jahrbüchern" abgedruckt. Vgl. dazu den Editorischen Bericht zu „Die drei reinen Typen“, unten, S. 717.
5
Die hier vorgenommene Eingliederung in die Edition der nachgelassenen Herrschaftstexte begründet sich aber durch die bereits angesprochene große thematische Nähe und werkbiographische Bedeutung dieses Textes. Mit Ausnahme eines im Zuge der Editionsarbeiten aufgefundenen Teilmanuskripts zum Text „Staat und Hierokratie“ Er erschien in: Preußische Jahrbücher, Band 187, Heft 1, Jan. 1922, S. 1–12.
6
basiert die Edition auf den entsprechenden Passagen der Erstausgabe von „Wirtschaft und Gesellschaft“, auf dem Abdruck in den [93]„Preußischen Jahrbüchern“ von 1922 und auf der Wiedergabe des Vortragsberichts in der Wiener „Neuen Freien Presse“ vorn 26. Oktober 1917. Die Edition beruht also zu großen Teilen auf postumer und indirekter Textüberlieferung, was – wie noch auszuführen – einen besonderen editorischen Umgang mit diesen Texten erforderlich machte. Vgl. unten, S. 587–609.
Die nachfolgend edierten Texte sind von Max Weber nicht selber zum Druck gegeben worden, sondern von ihm jahrelang – und wie man vermuten darf – mit Absicht zurückgehalten worden. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg warb der Verleger Paul Siebeck sehr beharrlich um die Freigabe der mehrfach angekündigten Soziologie,
7
aber ebenso ausdauernd weigerte sich Max Weber, dies zu tun.[93] So insbesondere in den Briefen von Paul Siebeck an Max Weber vom 20. April 1914 („gerade von Ihrem Beitrag verspreche ich mir besonders viel“) und vom 28. Juli 1914: „habe ich Arm in Arm mit Ihrer Frau Gemahlin bedauert, daß Sie sich nicht entschließen können, das Manuskript zum Druck zu geben“ (beide: VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446). Während des Krieges fragte Paul Siebeck regelmäßig nach, so in den Briefen vom 18. Februar 1915 oder 5. Mai 1916 (ebd.), bis er sich schließlich am 7. Dezember 1918 (ebd.) direkt an Marianne Weber wandte und versuchen wollte, sie in Abwesenheit ihres Mannes „zu einem Complott“ zu bewegen, d. h. die Manuskripte ohne dessen Wissen in den Satz zu geben.
8
Seine zunehmend barschen Antworten zeugen von der Unzufriedenheit mit dem Erreichten. In dem Brief vom 19. Juni 1914 an Paul Siebeck klingt Max Weber unleidlich, am 21. Juni 1914 bittet er ihn um Geduld (MWG II/8, S.721 f. und 727), und am 10. Mai 1916 vertröstet er ihn auf die Zeit nach dem Krieg (VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446; MWG II/9). Ein Großteil des Briefwechsels zwischen Max Weber und Paul Siebeck ist in Auszügen bei Winckelmann, Johannes, Max Webers hinterlassenes Hauptwerk: Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte. Entstehung und gedanklicher Aufbau. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1986, S. 22–49 (hinfort: Winckelmann, Webers hinterlassenes Hauptwerk), wiedergegeben.
9
Erst die Neufassung des „Grundriß“-Beitrages in den Jahren 1919/20 scheint seinen eigenen Ansprüchen Genüge getan zu haben. Gegenüber der Neufassung und deren Kapitel III. müssen wir die nachfolgend edierten Texte als eine Vorfassung ansehen, die ihr Autor als nicht veröffentlichungsreif angesehen hat. Ähnliches dürfte für den nachgelassenen Text „Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft“ gelten, der zwar sehr ausgearbeitet, aber dennoch Fragment geblieben ist. Vgl. dazu oben, S. 68 f.
10
Vgl. dazu den Editorischen Bericht, unten, S. 717–723.
Die in diesem Band edierten Texte zur „Herrschaftssoziologie“ variieren – wie die Editorischen Berichte zu den Einzeltexten im einzelnen belegen werden – in der Art der Darstellung und im Grad ihrer Fertigstellung. Einige Texte standen, wenn man formale Kriterien anlegt, der Drucklegung schon sehr nahe, während andere offensichtlich unfertig liegen geblieben [94]sind. Für eine direkte Druckvorbereitung spricht das Vorhandensein von Petitdruckpassagen, vor allem wenn sie die Texte durchgängig durchziehen und auf Weber selbst zurückzuführen sind. Petitdruck war für das „Handbuch der politischen Ökonomie" bereits im Mai 1910 zur platzsparenden Darstellung von Literaturübersichten und kontroverser Forschungsmeinungen vorgesehen worden.
11
Max Weber empfahl im Januar 1912 „Petit für Spezialausführungen“ und zur „Differenzierung des Druckes“ anläßlich der Umfangüberschreitungen des „Handbuch“-Beitrags von Friedrich von Wieser.[94] Vgl. die Vorbemerkung zum Stoffverteilungsplan für das „Handbuch der politischen Ökonomie“ vom Mai 1910, VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446 (MWG I/22-6 [[MWG I/24]]); abgedruckt in: Winckelmann, Webers hinterlassenes Hauptwerk (wie oben, S. 93, Anm. 8), S. 150 f., hier: die Unterpunkte 2. und 4.
12
Weber machte vom Petitdruck in der von ihm 1919/20 selbst in den Druck gegebenen ersten Lieferung reichlich Gebrauch, aber seine Verwendung findet sich auch in der postumen Ausgabe von „Wirtschaft und Gesellschaft“. Der dort wiedergegebene Petitdruck dürfte auch auf Weber selbst zurückgehen, wie die überlieferten Originalmanuskripte zum Bereich „Recht“ zeigen. Dort finden sich von der Hand Max Webers Markierungen mit der Setzeranweisung „Petit“. Brief Max Webers an Oskar und Paul Siebeck vom 31. Jan. 1912, MWG II/7, S. 418.
13
Da Marianne Weber das „Petit“ nicht besonders schätzte, Vgl. Weber, Die Wirtschaft und die Ordnungen, S. 6–13a (WuG1, S. 377–381), und ders., Recht § 1, S. 1–3 (WuG1, S. 386–387), ders., Recht § 2, S. 75 f. (WuG1, S. 454 f.).
14
darf man davon ausgehen, daß sie bei der Drucklegung keine zusätzlichen Passagen ins Petit gesetzt hat. Insofern geben die Petitdruckpassagen einen Hinweis auf den fortgeschrittenen Bearbeitungsstand der Texte. Brüche in der textinternen Verweisstruktur, die sich durch unterschiedliche Bearbeitungszeiträume oder Textumstellungen erklären lassen, Vgl, dazu den Vermerk Marianne Webers auf einem Brief des Verlages J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) vom 21. Mai 1921 (VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446) mit der Frage, wie weit die übersandten Manuskriptseiten in Petit gesetzt werden sollten. Marianne Weber fügte die Antwort handschriftlich bei: „Ich bitte hier nichts in Petit zu setzen, da mir gesagt wurde, daß den Lesern das ‚Petit‘ sehr unbequem ist.“
15
zeugen hingegen davon, daß Weber seine Texte nicht fertig überarbeitet hatte. Vgl. dazu die detaillierten Ausführungen unten, S. 106 f.
Der philologische Befund zu den überlieferten Herrschaftstexten lautet im Überblick: Uns liegt ein Einführungstext mit der Überschrift „Herrschaft“ vor, der aufgrund seiner Verweisformulierungen in einem unklaren Verhältnis zu den nachfolgend angeordneten Texten zur „Herrschaftssoziologie“ steht. Offensichtlich für den Druck vorbereitet war der Text „Bürokratismus“, der viele Petitdruckpassagen enthält und im ersten Teil in Stil und Gliederung der Darstellungsweise der späteren ersten Lieferung sehr [95]ähnelt. Er setzt aber unvermittelt ein und läßt eine herrschaftssoziologische Einführung in das Thema Bürokratie vermissen. Inhaltlich eng miteinander verflochten sind die beiden Texte „Patrimonialismus“ und „Feudalismus“, wobei der erstgenannte die meisten Verweisbrüche und Unstimmigkeiten in der Textkonstitution aufweist. Bei ihm ist ganz offensichtlich eine abschließende Überarbeitung unterblieben. Der Text „Charismatismus“ bricht mitten im Satz unvollendet ab. Jeweils neu einsetzend führen die beiden Texte „Umbildung des Charisma“ und „Erhaltung des Charisma“ das Thema der charismatischen Herrschaft unter verschiedenen Gesichtspunkten fort. Der Text „Erhaltung des Charisma“ war in der Erstausgabe unter dem nur teilweise zutreffenden Titel „Legitimität“ und abgetrennt von den anderen „Charisma“-Texten überliefert. Die textinterne Verweisstruktur spricht hier – im Gegensatz zur Anordnung der Erstausgabe – eindeutig für eine engere Verknüpfung der drei „Charisma“-Texte, zumal die Ausführungen am Ende des alten „Legitimitäts“-Kapitels direkt zum Text „Staat und Hierokratie“ überleiten, der die hier edierte Fassung der „Herrschaftssoziologie“ abschließt. „Staat und Hierokratie“ ist ein in sich abgerundeter Text, der aber auch – wie das im Original überlieferte Teilmanuskript belegt – mindestens zwei Bearbeitungsschichten aufweist. Zusammengefaßt lautet der philologische Befund zu den überlieferten Texten: Es liegt uns heute ein Konvolut von Texten vor, die offensichtlich verschiedenen Bearbeitungsphasen entstammen und abschließend nicht mehr in einen homogenen Zusammenhang gebracht worden sind. Es gibt folglich keine in sich abgeschlossene und druckfertige Fassung der älteren „Herrschaftssoziologie“.
Die Überlieferungslage ist, da wir für den größten Teil der Texte kein Originalmanuskript besitzen, durch die Erstausgabe von Marianne Weber geprägt. Sie beabsichtigte, die ihr vorliegenden Manuskripte zu „Wirtschaft und Gesellschaft“ in kürzester Zeit als das „nachgelassene Hauptwerk“, d. h. ein möglichst in sich geschlossenes Werk, ihres verstorbenen Mannes zu präsentieren.
16
Die überlieferte Korrespondenz mit dem Verlag J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) informiert über den technischen Ablauf der Drucklegung und gibt Einblicke in die Arbeitsweise Marianne Webers als Nachlaßverwalterin ihres Mannes. Wenige Tage nach den Trauerfeierlichkeiten in München schrieb sie am 30. Juni 1920 an den Verleger Paul Siebeck, daß sie im Schreibtisch ihres Mannes nachgelassene Manuskripte gefunden [96]habe: „Es ist offenbar druckfertig vorhanden: Religionssoziologie, Rechtssoziologie, dann Formen der Gesellschaft: (Ethnische Gemeinschaft, Sippen Nation Staat u. Hierokratie etc.) – ferner Formen der Herrschaft: (Charismatismus Patrimonialismus Feudalismus Bürokratismus) u. ein großes Konvolut: Formen der Stadt, u. schließlich ein höchst interessanter Abschnitt über Musiksoziologie.“[95] Vgl. Weber, Marianne, Vorwort [vom Oktober 1921], in: WuG1, S. III. Bereits vorher hatte sich Marianne Weber gegenüber Paul Honigsheim in einem Brief vom 29. Oktober 1920 über „Wirtschaft und Gesellschaft" geäußert: „Große Teile der künftigen Bände […] liegen im Schreibtisch, u. es wird nun die große Verantwortung sein alles richtig zu sichten u. herauszubringen.“ (Deponat Max Weber, BSB München, Ana 446).
17
Bis Anfang des Jahres 1921 standen noch die Abschlußarbeiten zur Drucklegung der von Max Weber im Verlag J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) begonnenen Bände zu den „Gesammelten Aufsätzen der Religionssoziologie“ und der neugefaßten ersten Lieferung zu „Wirtschaft und Gesellschaft“ im Vordergrund. Erst nach deren Erscheinen handelte Marianne Weber mit dem Verlag einen Vertrag über die Herausgabe der nachgelassenen Teile zu „Wirtschaft und Gesellschaft“ aus.[96] Brief von Marianne Weber an Paul Siebeck vom 30. Juni 1920, VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446.
18
Am 25. März 1921 übersandte sie ein hochversichertes Paket nach Tübingen. Ein erstes Vertragsangebot unterbreitete der Verlag J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) am 16. März 1921, die Verhandlungen zogen sich jedoch hin, da sich Marianne Weber als zähe Verhandlungspartnerin erwies. Der Vertrag wurde daher erst am 1. Juni 1921 unterzeichnet.
19
Ihre ursprüngliche Absicht, schwer lesbare Manuskriptteile – auch zur Sicherung des Bestandes – vorab abzudiktieren, setzte sie wohl nur teilweise um, so daß ein großer Teil des Paketinhalts aus handschriftlich verfaßten bzw. bearbeiteten Manuskriptsetten bestanden haben dürfte. Dies geht aus dem Brief von Marianne Weber an Oskar Siebeck vom 25. März 1921 (VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446) hervor, in dem es heißt: „Ich habe soeben das Manuskript eingepackt u. schicke es noch heute eingeschrieben an Sie ab.“
20
Wie aus dem gesonderten Schreiben an Oskar Siebeck hervorging, war sich Marianne Weber über die Anordnung der einzelnen Abschnitte noch nicht im klaren, vermutlich weil sie auch den Gesamtbestand des Manuskriptes, das nach ihren Aussagen „mindestens zwei Bände“ füllen werde, noch nicht im Detail überblicken konnte. Vgl. den Brief von Melchior Palyi an Oskar Siebeck vom 29. März 1921 (ebd.): Bevor Marianne Weber nach Heidelberg umgezogen ist. habe er „mit ihrer Hilfe und unter Hochdruck das Webersche Manuskript durchgesehen, geordnet und Ihnen zugesandt. Nur ein paar Blätter sind zurückgeblieben, teils um von Frau Professor abdiktiert und somit gerettet zu werden, weil sonst unbrauchbar, teils weil es lose Blätter sind, die ich in der Eile nicht wußte[,]) wo zu unterbringen [sic!] und sie in den Fahnen an passender Stelle einzuhalten [sic!] werde.“
21
Dem Paket legte sie einen klei[97]nen Notizzettel mit der „vorläufig beschlossenen Reihenfolge der Abschnitte“ bei. Marianne Weber schrieb am 25. März 1921, begleitend zur Übersendung der nachgelassenen Manuskripte, an Oskar Siebeck: „Ob wir bei der vorläufig beschlossenen Reihenfolge der Abschnitte genau festhalten können[,] läßt sich heute noch nicht übersehen. Es ist möglich, daß Verschiebungen vorgenommen werden müssen, das wird ja aber für die Druckerei nichts ausmachen. Ich nehme an, daß die Manuskripte minde[97]Stens zwei Bände füllen werden. Natürlich wäre es zweckmäßig die Fahnenkorrektur erst umzubrechen, wenn der eine Band völlig gesetzt ist; denn erst wenn altes im Satz vorliegt, kann man den genauen Überblick gewinnen und die Reihenfolge definitiv festsetzen.“ (ebd.).
22
Für die „Herrschaftssoziologie“ lautete diese: Vgl. den Brief von Marianne Weber an Oskar Siebeck vom 25. März 1921 (ebd.).
23
Weber, Marianne, Notizzettel mit der Auflistung des Manuskriptbestands vom 25. März 1921 (ebd.).
- „8) Herrschaft
- 9) Politische Gemeinschaften
- 10) Machtgebilde: ‚Nation‘
- 11) Klasse, Stand, Parteien
- 12) Legitimität
- 13) Bürokratismus
- 14) Patrimonialismus
- 15) Charismatismus
- 16) Umbildung des Charisma (fehlt Schluß)24Die Angabe muß sich wohl auf den Text „Charismatismus“ beziehen und ist in der Aufstellung offensichtlich eine Zeile nach unten gerutscht.
- 17) Feudalismus
- 18) Staat u. Hierokratie“
Der hier genannte Bestand wurde von Marianne Weber als dritter Teil von „Wirtschaft und Gesellschaft“ unter dem Titel „Typen der Herrschaft“ zusammengefaßt. Die intensive Arbeit an ihm setzte aber erst nach Fertigstellung des zweiten Teils ein, der im November 1921 und April 1922 als zweite und dritte Lieferung erschienen war.
25
Die Hauptaufgabe des Verlages bzw. der Setzerei bestand zunächst darin, das umfangreiche und wohl in großen Teilen schwer lesbare Manuskript zu setzen. Ein Blick in ein Originalmanuskript Max Webers macht schnell deutlich, welche Entzifferungsschwierigkeiten damit – auch für erfahrene Setzer – verbunden gewesen sein müssen. Wo der Setzer nicht mehr weiterwußte, finden sich im Originalmanuskript Markierungen, Zum Erscheinen der zweiten und dritten Lieferung vgl. den Brief von Werner Siebeck an Marianne Weber vom 10. Nov. 1921 (VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446), in dem es um den Versand der zweiten Lieferung ging, sowie den Brief des Verlages J.C.B. Mohr an Marianne Weber vom 4. Mai 1922 (ebd.), mit dem sie die Honorarabrechnung für die dritte Lieferung und eine Versandliste für die Freiexemplare erhielt.
26
die als Rückfragen an Marianne Weber oder die anderen Korrektoren gingen. Auf seiten des Verlages las der [98]pensionierte Dekan Karl Zeller zusätzlich alle Fahnen Korrektur, So sind z. B. im Manuskript zu „Staat und Hierokratie“ die Wörter „Gudea’s“, „Ossifljanen“, „Heerden“ blau markiert, unten, S. 691 mit Anm. o, S. 704 mit Anm. c, und S. 694 mit Anm. a.
27
während Marianne Weber in ihrer Arbeit von Schülern, Freunden und Kollegen ihres Mannes, insbesondere von Melchior Palyi, unterstützt wurde. Im Januar 1922 notierte Marianne Weber, daß sie „die Fahnen sämmtlicher Abschnitte der 3. u. 4. Lieferung“ bereits zweimal Korrektur gelesen habe.[98] Vgl. dazu den Brief von Marianne Weber an Werner Siebeck vom 20. Febr. 1922, oder die Karten des Verlages an Marianne Weber vom 1. und 5. Apr. 1922 (VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446).
28
Parallel dazu korrigierte Palyi, der sich gegenüber dem Verleger über die sachlichen Probleme äußerte, die die Korrektur der Fahnen mit sich brachte: „Ich bitte Sie nur vielleicht gelegentlich einmal in einer Mußestunde den Versuch zu machen, irgend eine Seite etwa aus der Rechts- oder der Religionssoziologie rein textuel [sic!] und auf die Fremdwörter hin nachzuprüfen, und unsere Korrekturen nachzusehen. Dabei bitte ich zu beachten, daß nicht nur die korrigierten Stellen, sondern alle irgendwie zweifelhaften nachgeprüft werden mußten, auf inhaltlichen Zusammenhang wie auf Rechtschreibung hin; ferner bitte ich zu beachten, um nur eines hervorzuheben, daß zu solchen Korrekturen vielfach weder unsere Kenntnisse noch auch die mir zugänglichen Handbücher ohne weiteres ausreichen, sondern eingehende fachmännische Beratung nötig ist […].“ Brief von Marianne Weber an Oskar Siebeck vom 27. Jan. 1922 (ebd.).
29
Ein Vergleich zwischen den überlieferten Originalmanuskripten und der Druckfassung von „Wirtschaft und Gesellschaft“ belegt auch, daß die Korrekturen nicht nur inhaltlicher Natur waren, sondern auch die formale Vereinheitlichung betrafen. Offensichtliche Unstimmigkeiten in Orthographie, Satzbau und Anordnung wurden verbessert, die Rechtschreibung nach dem Duden aktualisiert, fehlende Überschriften und Kapitelüberschriften nachgeführt, die Zählung der Zwischenüberschriften vereinheitlicht. Brief von Melchior Palyi an Oskar Siebeck vom 6. Sept. 1921 (ebd.).
30
Ein Großteil der genannten Eingriffe sind redaktioneller Art und durch die Absicht Marianne Webers erklärbar, ein möglichst geschlossenes Buch und keine Ansammlung von Manuskripten zu präsentieren. Vgl. dazu die Bemerkungen im Editorischen Bericht zu „Staat und Hierokratie“, unten, S. 573–575, wo die Abweichungen der Erstausgabe vom Originalmanuskript behandelt werden; zu den nachgeführten Überschriften und Kapitelübersichten vgl. die Ausführungen, unten, S. 107–110.
Die Korrekturen zogen sich deshalb länger hin als gedacht. Seitens des Verlages wurde insbesondere Melchior Palyi für die Verzögerungen bei der Fertigstellung der vierten Lieferung verantwortlich gemacht. Einerseits behinderten seine sachlichen Skrupel den Fortgang der Arbeiten, [99]durch seine beruflichen Verpflichtungen fand er nur noch wenig Zeit für die Korrekturarbeiten, und andererseits passierten einige Schnitzer, die beim Verlag für Verwirrung sorgten: Fahnen verschwanden und tauchten teilweise wieder auf,
31
Palyi änderte die zwischen dem Verlag und Marianne Weber vereinbarte Kapitelzählung im Bereich der „Herrschaftssoziologie“ – die vereinbarte Neuzählung hatte Palyi wieder gestrichen, so daß der Verlag irritiert um eine verbindliche Regelung bat[99] Marianne Weber schrieb am 20. Februar 1922 an Werner Siebeck: „Der Verlust der Fahnenkorrekturen der 3. u. 4. Lieferung ist dadurch so unangenehm, weil damit ja auch meine zweite Lesung u. die des Herrn Dekan Zeller verloren ist – ich also eigentlich noch einmal eine Fahnenrevision lesen müßte! Hoffentlich geht es auch so. Wie gut wäre es, wenn Dr. Palyi die Teile doch noch bei sich gefunden hätte.“ (VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446). Am 24. Februar 1922 teilte Melchior Palyi in einer Karte an den Verlag jedoch mit: „Die fehlenden Fahnen sind gefunden und ich bin an der Korrektur.“ (ebd.).
32
– und schließlich ordnete er in der allerletzten Phase der Drucklegung noch eine Kapitelumstellung an. Das Kapitel „Wirkungen des Patriarchalismus und des Feudalismus“ (jetzt: „Feudalismus“) sollte noch vor das Kapitel „Charismatismus“ gestellt werden. Vgl. den Brief des Verlages an Marianne Weber vom 1. Mai 1922 (ebd.).
33
Um das Erscheinen der vierten Lieferung zum September 1922 nicht zu gefährden, setzte der Verlag durch, daß Melchior Palyi von der Revision der Fahnen ausgeschlossen und die Erstellung des Gesamtregisters an eine Vertrauensperson des Verlages übergeben wurde. Vgl. den Brief von Melchior Palyi an den Verlag vom 15. Juli 1922 (ebd.).
34
Marianne Weber teilte am 2. Mai 1922 in einer Karte an den Verlag mit: „Die Korrekturen gehen nur an mich – es handelt sich ja um die letzte Revision, Dr. Palyi braucht sie nicht mehr lesen." (ebd.). Die Klagen des Verlages über Palyis Arbeit häufen sich seit Juni, als Palyi immer noch kleine Korrektursendungen an den Verlag schickte. Vgl. insbes. den Protest von Oskar Siebeck in einem Brief an Marianne Weber vom 29. Juni 1922 (ebd.).
Ein Vergleich zwischen der im Verlag J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) hergestellten Ausgabe der „Herrschaftssoziologie“ und der postumen Ausgabe des Manuskriptes „Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft“ im Verlag Georg Stilke zeigt, daß sich in der letztgenannten Publikation eine wesentlich höhere Quote von Fehlern bzw. Weber-untypischen Schreibweisen findet.
35
Die Textausgabe von „Wirtschaft und Gesellschaft“ scheint demgegenüber sorgfältiger und zuverlässiger angefertigt worden zu sein. Dies könnte seinen Grund auch darin haben, daß Max Weber dem Tübinger Verlagshaus mit seiner teilweise schwer zu entziffernden Handschrift als langjähriger Autor wohlbekannt war. Trotz der genannten und noch im [100]einzelnen zu beschreibenden Eingriffe bilden die Erstausgaben von Marianne Weber im „Grundriß“ und in den „Preußischen Jahrbüchern“ die Hauptgrundlage für die hier vorgelegte historisch-kritische Edition. Diese Textzeugen haben im Unterschied zu allen späteren Ausgaben den Vorzug, daß ihre Herstellung auf den Originalmanuskripten Max Webers beruhte. Sie stehen dem Original daher nicht nur zeitlich am nächsten. Die Edition ist bestrebt, die überlieferten Texte von den offensichtlichen Eingriffen der Erstherausgeber zu bereinigen. Vgl. dazu den Editorischen Bericht zu „Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft“, unten, S.725.
II. Bandspezifische Editionsfragen
Zur Anordnung der Texte in diesem Band. In Teil I. werden die Texte der älteren Fassung der „Herrschaftssoziologie“ vorgelegt, allerdings in einer gegenüber der Anordnung der Erstausgabe von „Wirtschaft und Gesellschaft“ geänderten Reihenfolge. Marianne Weber gab bedauernd an, daß es keinen Plan Max Webers gegeben habe, nach dem sie die nachgelassenen Schriften hätte anordnen können.
36
Sie ging davon aus, daß die „Einteilung“ zum „Grundriß der Sozialökonomik“ von 1914 bereits verlassen worden war und stellte daher eine eigene Abfolge auf, die aber – wie die Korrekturen in der Auflistung vom 25. März 1921 zeigen – eine sehr schwankende und unsichere war.[100] Vgl. Weber. Marianne. Vorwort [vom Oktober 1921]. in: WuG1, S. III.
37
Die Aufstellung wird hier zweimal wiedergegeben, um die Umschichtungen der einzelnen Kapitel deutlich zu machen: Weber, Marianne, Notizzettel mit der Auflistung des Manuskriptbestands vom 25. März 1921 (VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446).
| „8) Herrschaft | „8) Herrschaft |
| 8a > 9) Politische Gemeinschaften 〈|:9a) Klasse, Stand, Parteien:|〉 | 9) Politische Gemeinschaften |
| 9 > 10) Machtgebilde: ‚Nation‘ | 10) Machtgebilde: ‚Nation‘ |
| 11) Klasse, Stand, Parteien | 11) Klasse, Stand, Parteien |
| 12) Legitimität | 12) Legitimität |
| 13) Patrimonialismus | 13) Bürokratismus |
| 14) Charismatismus | 14) Patrimonialismus |
| 15) Umbildung des Charisma (fehlt Schluß) | 15) Charismatismus |
| 16) Feudalismus | 16) Umbildung des Charisma (fehlt Schluß) |
| 17) Staat u. Hierokratie | 17) Feudalismus |
| 18) Bürokratie“ | 18) Staat u. Hierokratie“ |
[101]Es fallen insbesondere zwei Entscheidungen auf: Marianne Weber stellte den Text „Bürokratismus“ zunächst an den Schluß, weil sie vermutlich von einem entwicklungshistorischen Ansatz ausging, dann aber feststellen mußte, daß er unbedingt vor die Texte über die patrimoniale und charismatische Herrschaft gehöre. Das „Feudalismus“-Kapitel findet sich jeweils hinter den beiden Texten „Charismatismus“ und „Umbildung des Charisma“, was der Anordnung in der ersten Lieferung entspricht, wo der „Feudalismus“ dem Abschnitt über die „Veralltäglichung des Charisma“ nachgeordnet ist.
38
– Möglicherweise entsprang auch die Einfügung des „Legitimitäts“-Kapitel in den Anfangsbereich der „Herrschaftssoziologie“ der Orientierung Marianne Webers am Aufbau des Kapitels „Die Typen der Herrschaft“ in der ersten Lieferung. – Bezüglich des „Feudalismus“-Kapitels veranlaßte Melchior Palyi, wie bereits angesprochen, kurz vor dem Endausdruck die Umstellung des Textes vor die beiden „Charisma“-Kapitel.[101] Vgl. Weber, Max, Die Typen der Herrschaft, in: WuG1, S. 148 ff. (MWG 1/23); dort als Abschnitt 6.
39
Die beiden Optionen weisen auf zwei unterschiedliche systematische Zuordnungen des „Feudalismus“ hin. Der Vorschlag von Marianne Weber klassifiziert ihn – in Analogie zur Entscheidung Max Webers von 1919/20 – als Mischform von Elementen der traditionalen und charismatischen Herrschaft, während der Vorschlag von Melchior Palyi ihn schwerpunktmäßig den traditionalen Herrschaftsformen zuweist, so daß der „Feudalismus“ – wie Weber es in der älteren Fassung beschrieb – als „äußerster ,Grenzfall‘ des Patrimonialismus“ behandelt wurde und daher auch in dessen unmittelbarer Nähe anzuordnen war. Vgl. den Brief von Melchior Palyi an Oskar Siebeck vom 15. Juli 1922 (VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446).
40
Vgl. den Hinweis im Text „Patrimonialismus“, unten, S. 370.
Die von Marianne Weber und Melchior Palyi vorgenommene Textanordnung konnte aus den genannten Gründen von der Edition nicht ohne Prüfung und Abänderungen übernommen werden. Auch der „Grundriß“-Plan von 1914 erwies sich als wenig hilfreich, da er, wie schon ausgeführt, als eine Projektion für den Abschluß der Manuskriptüberarbeitung anzusehen ist, aber im Augenblick seiner Niederschrift nicht den Bearbeitungsstand der uns überlieferten „Herrschaftssoziologie“ widerspiegelt.
41
Am aussagekräftigsten wäre die von Weber am Jahresende 1913 in Aussicht gestellte Inhaltsübersicht gewesen, die uns aber nicht überliefert ist. Vgl. dazu oben, S. 68–70.
42
Eine [102]chronologische Anordnung nach der Entstehungszeit erwies sich als nicht durchführbar, da die Texte meist mehrfach überarbeitet worden sind und sich deshalb eine zweifelsfreie Datierung nicht vornehmen ließ. Für die Anordnung und Rekonstruktion der Textabfolge in der historisch-kritischen Edition mußten folglich andere Kriterien herangezogen werden. Dies sind vor allem die textinternen Verweise sowie die in die Texte eingefügten skizzenhaften Beschreibungen des weiteren Vorgehens, die oft den Charakter von direkten Überleitungen von einem Text zum nächsten haben. Daraus ergab sich – auch im Zusammenhang mit den bereits vorgestellten konzeptionellen Überlegungen – folgender Aufbau des Bandes: In dem Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 30. Dez. 1913 heißt es: „Ich schicke Ihnen in 14 Tagen erst einmal die Inhaltsübersicht“; diese ist jedoch nicht überliefert. Vgl. dazu MWG 11/8, S. 450 mit der Hg.-Anm. 14.
Auf den einleitenden Text „Herrschaft“ folgt unmittelbar der „Bürokratismus“-Text, und von diesem ausgehend ergibt sich dann die Abfolge der weiteren Darstellung: Sie geht von der rationalsten Herrschaftsform über die vormodernen Formen der Vergangenheit („Patrimonialismus“ und „Feudalismus“) bis hin zu den nicht-rationalen (charismatischen) Herrschaftsformen und deren Umwandlung. Abweichend von der Erstausgabe wurden die kürzeren, auf das Einleitungskapitel folgenden Texte über „Politische Gemeinschaften“, „Machtgebilde. ‚Nation‘“ sowie „Klasse, Stand, Parteien“ aus dem Verbund der „Herrschaftssoziologie“ ausgesondert. Sie sind im Teilband „Gemeinschaften“ ediert.
43
Das Kapitel „Legitimität“, das dem „Bürokratie“-Kapitel voranging, wurde unter dem neuen Titel „Erhaltung des Charisma“ hinter den Text „Umbildung des Charisma“ gestellt,[102] Vgl. Weber, Politische Gemeinschaften, MWG I/22-1, S. 200–217, ders., Machtprestige und Nationalgefühl, ebd., S. 218–247, ders., „Klassen“, „Stände“ und „Parteien“, ebd., S. 248–272, sowie ders., Kriegerstände, ebd., S. 275–281.
44
wohin es thematisch und aufgrund der Verweisstruktur gehört. Seine abschließende Passage über die legitimitätsstiftende Funktion des Charisma leitet direkt zu den einleitenden Ausführungen des Textes „Staat und Hierokratie“ über. Vgl. unten, S. 542–563, sowie die detaillierten Ausführungen im Editorischen Bericht zu „Erhaltung des Charisma“, unten, S. 538 f.
45
Dieser knüpft zwar an das Vorangehende an, bietet aber insgesamt in der Abfolge der Herrschaftstexte mit der Untersuchung des spannungsreichen Verhältnisses von politischer und priesterlicher Herrschaft etwas konzeptionell Neues. Von diesem Text ist ein sechsseitiges Originalmanuskript überliefert, das an der entsprechenden Stelle die Textwiedergabe der Erstausgabe ablöst. Vgl. unten, S. 558–563 und 579 f.
46
In einem Anhang zum Text wird das Manuskript ausführlich – mithilfe diakritischer Zeichen – wieder[103]gegeben. Unten, S. 587–609.
47
Es vermittelt nicht nur einen Eindruck von Webers Art zu schreiben, sondern illustriert sehr plastisch die Probleme der Textwiedergabe. Mit den Ausführungen über „Staat und Hierokratie“ endet, da keine weiteren Texte überliefert sind, die „Herrschaftssoziologie“ der älteren Fassung von „Wirtschaft und Gesellschaft“. Auf dem Weg zur Neufassung in den Jahren 1919/20 bilden der indirekt überlieferte Vortragstext „Probleme der Staatssoziologie“ vom Oktober 1917 und der vermutlich in den Jahren 1917/18 entstandene Text „Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft“ zwei wichtige werkbiographische Zwischenglieder. Sie sind entsprechend ihrer gesonderten Überlieferungslage – sie gehören nicht zum Bestand von „Wirtschaft und Gesellschaft“ – im Anschluß an die ältere Fassung der „Herrschaftssoziologie“ ediert.[103] Unten, S. 683–713.
48
Wegen ihrer unterschiedlichen formalen textlichen Zuordnung werden sie als Teil II. und III. des Bandes vorgelegt. Unten, S. 745–756 und 717–742.
Editorische Berichte. Aus der Darlegung der Überlieferungslage zur „Herrschaftssoziologie“ wird deutlich, daß Marianne Weber bereits in der frühesten Auflistung der vorgefundenen Manuskripte im Juni 1920 die „Religions“- und „Rechtssoziologie“ als nahezu druckfertige und jeweils in sich geschlossene Konvolute wahrnahm, während sie bei der „Herrschaftssoziologie“ wesentlich vager von „Formen der Herrschaft“ und einzelnen Teilaspekten sprach.
49
„Religions“- und „Rechtssoziologie“ waren, wie auch das Originalmanuskript zur letzteren belegt, von Weber für den Druck überarbeitete Manuskripte, in denen die einzelnen Abschnitte bzw. Paragraphen in einer erkennbar festgelegten Reihenfolge standen. Bei der „Herrschaftssoziologie“ scheint dies nicht der Fall gewesen zu sein. Hier lagen offensichtlich einzelne Manuskripte in keiner eindeutig erkennbaren und verbindlichen Abfolge vor. Marianne Weber und Melchior Palyi hätten sonst nicht bis zum Schluß in der Anordnung geschwankt. Außerdem behandelten sie – im Gegensatz zu den einzelnen Abschnitten der „Rechts“- und „Religionssoziologie“ – die einzelnen Texte der „Herrschaftssoziologie“ als eigenständige Kapitel. Die formale Behandlung der unterschiedlichen Manuskriptbestände muß folglich auch in der Neuedition eine abweichende sein. Die Unsicherheiten im Umgang mit den Herrschaftstexten, die sich in der Erstausgabe widerspiegeln, sollen hier nicht verdeckt werden. Auch die jetzige Anordnung der Texte ist Editorenwerk. Die hier gewählte, gesonderte editorische Behandlung der einzelnen Tex[104]te trägt diesem Umstand Rechnung. Sie macht damit deutlich, daß Max Webers Vorkriegsfassung der „Herrschaftssoziologie“ keine druckfertige und in sich geschlossene Abhandlung war. Andererseits lag Marianne Weber auch kein völlig unstrukturiertes Manuskript vor, sie konnte sehr klar thematische Einheiten benennen, die wohl einzelnen, auch optisch abgegrenzten Konvoluten entsprachen. Vgl. dazu den bereits oben (S. 96) zitierten Brief von Marianne Weber an Paul Siebeck vom 30. Juni 1920 (VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446).
Die Editorischen Berichte informieren kurz über den jeweiligen Aufbau der Einzeltexte, charakterisieren den Textzustand (Fertigstellungsgrad, Inkonsistenzen, Wiederholungen), stellen die im Text enthaltenen Datierungshinweise zusammen, werten die textinternen Verweise aus und bestimmen dadurch die Position des jeweiligen Textes im überlieferten Textbestand der „Herrschaftssoziologie“ und zu den anderen Bereichen von „Wirtschaft und Gesellschaft“. Erwähnt werden ferner editorische Besonderheiten des Textes, wie z. B. geänderte Überschriften, Eingriffe der Erstherausgeber und Emendationen.
Zur Datierung der Texte. Die überlieferten Originalmanuskripte zu „Wirtschaft und Gesellschaft“ machen, unabhängig von ihrem jeweiligen Umfang, eines sehr deutlich: Es dürfte kaum einen Text Max Webers geben, der von ihm nicht mindestens einmal gründlich überarbeitet und erweitert worden ist. Besonders die überlieferten Manuskripte zum Text „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ und zur „Rechtssoziologie“ belegen, daß Weber nicht nur maschinengeschriebene Texte handschriftlich verbesserte und erheblich erweiterte, sondern auch in scheinbar fertige Textpassagen ganze Konvolute von neu geschriebenen maschinenschriftlichen Seiten hineinfächerte. Bei diesen Überarbeitungen und Ergänzungen schob er auch Manuskriptteile von einem Kapitel in ein anderes.
50
Wir müssen uns also auch von der Vorstellung verabschieden, daß Weber jedes Kapitel gesondert für sich bearbeitet hat. Das gesamte Manuskript ist bei Max Weber im Arbeitsprozeß stets variabel, und die einzelnen Kapitelbegrenzungen sind, ebenso wie ganze Textpassagen, disponibel. Es ist daher möglich – wie die nicht auflösbaren Verweise indizieren –, daß Textstellen ganz verworfen oder für andere Werkbereiche, wie insbesondere die Aufsätze zur „Wirtschaftsethik der Weltreligionen“, weiterverwendet werden konnten.[104] So finden sich Teile der ältesten Schreibmaschinenfassung des Textes „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ in Recht §§ 1 und 3 wieder. Vgl. dazu oben, S.79 f. mit Anm.29.
51
Dies ist teilweise bei den Ausführungen über China der Fall, vgl. dazu den Editorischen Bericht zum Text „Patrimonialismus“, unten, S. 242.
Bei der Datierung der Herrschaftstexte geht es daher nicht nur um die Bestimmung des frühestmöglichen Abfassungszeitpunkts der einzelnen [105]Texte, sondern vor allem auch um den spätestmöglichen Bearbeitungszeitpunkt. Aussagen zur Datierung sind aufgrund der beschriebenen Manuskripte zusätzlich mit Vorsicht zu behandeln, denn der Hinweis auf die Zitation eines „neuerdings“ erschienenen Buches oder Aufsatzes besagt nur, daß die entsprechende Textpassage kurz darauf bearbeitet worden ist. Möglicherweise kann es sich auch nur um einen Einschub handeln, so daß es fälschlich wäre, von dieser einen Nennung auf eine vollständige Bearbeitung des gesamten Kapitels oder Textes Rückschlüsse zu ziehen. Die in den Editorischen Berichten zusammengestellten Hinweise bieten daher oft nur Indizien zu einer Datierung des Gesamttextes. Unabhängig von den textimmanenten Hinweisen wurden für die zeitliche Einordnung werkbiographisch oder thematisch relevante Hinweise aus der Korrespondenz Max Webers herangezogen.
52
Konkret ausgewertet wurden die in den Texten enthaltenen Informationen, wie die explizit genannte Literatur, die offensichtlich benutzte Literatur sowie die Anspielungen auf zeitgenössische Forschungsdiskussionen. Zusätzlich boten die von Weber in die Texte eingeflochtenen Beispiele, insbesondere zur aktuellen Politik, wichtige Datierungshinweise, wie beispielsweise der Rekurs auf die amerikanischen Präsidentschaftswahlen „im letzten Jahr“.[105] Vgl. den Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 3. November 1913 über Büchers „Minderleistung“ (Editorischer Bericht zum Text „Feudalismus“, unten, S. 373), den Brief Max Webers an Arthur Salz vom 15. oder 22. Februar 1912 über Charisma und Tradition bei Stefan George (Editorischer Bericht zum Text „Charismatismus“, unten, S. 456) und den Brief Max Webers an Georg von Below vom 21. Juni 1914 über den Begriff „Patrimonialismus“ (Editorischer Bericht zum Text „Patrimonialismus“, unten, S. 238).
53
Vgl. unten, S. 512, sowie den Editorischen Bericht zum Text „Umbildung des Charisma“, unten. S. 473 f.
Ein weiteres wichtiges Kriterium für die relative Chronologie war die Nähe oder Ferne des jeweiligen Textes zum „Kategorienaufsatz“. Im überlieferten Originalmanuskript zum Text „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ läßt sich eindeutig ablesen, daß Weber die Kategorie des „Einverständnishandelns“ nachträglich in das Typoskript hineingearbeitet hat. Nimmt man für die „Herrschaftssoziologie“ eine vergleichbare Manuskriptlage an, dann müßten die Texte mit den spezifisch soziologischen Kategorien gleichzeitig oder nach Abfassung des Kategorienaufsatzes niedergeschrieben bzw. überarbeitet worden sein, und diejenigen Texte, wo sie ganz fehlen, einem früheren Abfassungszeitpunkt angehören. Wie oben bereits dargelegt, ist bei einem Großteil der Herrschaftstexte die Verwendung der soziologischen Kategorien zumeist auf bestimmte Textpassagen begrenzt, was wohl eher für eine nachträgliche Einfügung spricht.
54
Vgl. dazu die Ausführungen oben. S. 65 f.
[106]Auch die spezifische Verwendung des Begriffs „Patrimonialismus“ und der ihm zugehörigen Wortbildungen ist als ein Kriterium für die Bestimmung der zeitlichen Abfolge oder Zusammengehörigkeit von Texten herangezogen worden.
55
In dieser Weise liefert auch die Verweisstruktur indirekte Hinweise zur Datierung, wie gleich auszuführen ist. [106] Vgl. dazu die Editorischen Berichte zu „Patrimonialismus“ und „Feudalismus", unten, S. 239–241 und 374.
Zusammengefaßt lauten die Datierungsbefunde für die einzelnen Herrschaftstexte:
56
Zum ältesten Bestand dürften die drei Texte „Bürokratismus“, „Patrimonialismus“ und „Feudalismus“ gehören, wobei jedoch die letzte nachweisliche Überarbeitung der beiden Texte zur traditionellen Herrschaft in das Frühjahr bzw. den Frühsommer 1914 weist, beim „Bürokratismus“-Text hingegen das Jahr 1913 nicht überschreitet. Die Abfassung und letzte Bearbeitung der Texte „Herrschaft“, „Umbildung des Charisma“ und „Erhaltung des Charisma“ weist in die Jahre 1912/13, während der abgebrochene „Charismatismus“-Text wohl vor den anderen beiden „Charisma“-Texten abgefaßt worden ist. Dies dürfte auch für weite Passagen des Textes „Staat und Hierokratie“ zutreffen, der aber später noch partiell überarbeitet wurde, wie das Manuskriptfragment nahelegt. Die Spezialinformationen und Begründungen finden sich in den jeweiligen Editorischen Berichten.
Die textinterne Verweisstruktur der Nachlaßtexte von „Wirtschaft und Gesellschaft“ ist von Hiroshi Orihara eingehend untersucht worden.
57
Mit ihm lassen sich die Verweise in Voraus-, Rück- und Andernortsverweise einteilen. Der Aussagewert der einzelnen Verweise ist jedoch sehr unterschiedlich. Er hängt entscheidend davon ab, ob sich eindeutige Bezugsstellen im überlieferten Textbestand auffinden lassen. Verweise, die sich auf mehrere Stellen beziehen können, sind weniger aussagekräftig, während wechselseitige Verweise für eine gemeinsame Bearbeitung von Textpassagen sprechen. Die von Max Weber eingefügten Verweise sind im Zuge der Editionsarbeiten für die Texte der „Herrschaftssoziologie“ intensiv untersucht worden, um deren Verhältnis zueinander und damit auch ihre Abfolge zu bestimmen. Neben dieser Funktion der Verweise, themati[107]sche Brücken zwischen verschiedenen Textpassagen herzustellen, ergab sich aber noch ein zweiter, für die historisch-kritische Edition nachgelassener Texte bedeutsamer Informationsgehalt. Er läßt sich an einem Beispiel gut illustrieren: Max Weber verweist auf die Entwicklung der abendländischen Musik, die „hier nicht nachgewiesen werden kann“. Äußerst hilfreich für die systematische Behandlung der textinternen Verweisstruktur und deren kritische Überprüfung waren die sehr detaillierten Studien und die auf diesen beruhenden tabellarischen Übersichten von Hiroshi Orihara, der in einer Aufsatzfolge alle textinternen Verweise der älteren Fassung von „Wirtschaft und Gesellschaft“ zusammengestellt und Verweisauflösungen angeführt hat. Auf dieser Grundlage hat er u. a. die Umstellung einiger Texte gefordert. (Vgl. Orihara I, II, III (wie oben, S. 78, Anm. 24)). Durch die intensive Arbeit mit den überlieferten Originalmanuskripten zu „Wirtschaft und Gesellschaft“ ergab sich an einigen Stellen eine andere Auflösung und Bewertung der Verweise.
58
Der Verweis, der sich im überlieferten Manuskriptfragment zum Text „Staat und Hierokratie“ befindet, besagt zunächst, daß eine musiksoziologische Studie, zumindest im konkreten Planungsstadium, vorlag, und daß diese bereits aus dem Werkzusammenhang von „Wirtschaft und Gesellschaft“ herausgenommen worden ist, denn sonst hätte die entsprechende Formulierung „wie später auszuführen“ oder ähnlich gelautet. Da sich die betreffende Stelle auf nachträglich eingefügten Manuskriptseiten befindet, weist sie im Vergleich zum Kernbestand des Textes auf einen späteren Bearbeitungszeitpunkt hin. Die Verweisformulierungen geben somit auch Hinweise auf die Datierung der Texte. Aus diesem Grund sind die in den zu „Wirtschaft und Gesellschaft“ überlieferten Originalmanuskripten enthaltenen Verweise von besonderem Aussagewert und daher auch detailliert für die Herrschaftstexte ausgewertet worden.[107] Vgl. unten, S. 597 mit Anm. 37, sowie den Editorischen Bericht zum Text „Staat und Hierokratie“, unten, S. 566 f.
59
Aber auch schon die Häufigkeit von Verweisen kann Indizien für die zeitliche Abfolge der Textentstehung bzw. -bearbeitung liefern, wie dies bereits am Beispiel der „Religiösen Gemeinschaften“ und dem Text „Staat und Hierokratie“ dargestellt worden ist. Vgl. dazu auch die Ausführungen, oben, S. 79–83.
60
Die textinternen Verweise stellen somit – trotz der genannten Unwägbarkeiten – ein wichtiges Kriterium zur philologischen Detailanalyse der Texte dar und sind deshalb in den einzelnen Editorischen Berichten zusammengestellt worden. Vgl. dazu oben, S. 76–78.
Die Überschriften und Zwischenüberschriften, die in der Erstausgabe von Marianne Weber und Melchior Palyi als Kapitelüberschriften bzw. Zwischentitel enthalten sind, können nicht mit Bestimmtheit als autoreigene Titel Max Webers betrachtet werden.
61
Im Vergleich zu den zweifelsfrei von Weber stammenden und ausgearbeiteten Überschriften in den Originalmanuskripten zu den Texten „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ und der „Rechtssoziologie“, Zu den Zweifeln an der Authentizität der Überschriften vgl. Mommsen, Wolfgang J., Einleitung, in: MWG 1/22–1, S. 60–64.
62
handelt es sich bei den überlieferten Titeln zur [108]„Herrschaft“ um stichwortartige Umschreibungen des Inhalts. Möglicherweise hatte Max Weber einzelne Konvolute der nachgelassenen Manuskripte in Mappen oder Briefumschlägen aufbewahrt und zur besseren Orientierung mit Stichworten oder Arbeitstiteln versehen. Vgl. Weber, Die Wirtschaft und die Ordnungen, S. 1, 4 und 14 (WuG1, S. 368, 374, 381), zu Weber, Recht §§ 1–7, sind die Überschriften teilweise doppelt vorhanden, einmal als Einfügungen auf den Manuskriptblättern und für die §§ 1–6 zusätzlich auf den [108]eingefügten Zwischenblättern, unter Beifügung der Inhaltsübersichten. Diese offensichtlich spät eingelegten Zwischenblätter sind nicht paginiert (WuG1, S. 386, 396, 412, 455, 467, 481, 495).
63
Dies könnte ein Grund sein, weshalb Marianne Weber bereits wenige Tage nach dem Tod ihres Mannes einen Überblick über die im Schreibtisch vorgefundenen und noch nicht veröffentlichten Manuskripte hatte und gegenüber dem Verleger Paul Siebeck den Inhalt einzelner Teile stichwortartig benennen konnte. Vgl. dazu auch Mommsen, Wolfgang J., Einleitung, in: MWG I/22-1, S.61.
64
Einige dieser von Marianne Weber ursprünglich angegebenen Bezeichnungen wurden im Laufe der Drucklegung verändert, Vgl. den Brief von Marianne Weber an Paul Siebeck vom 30. Juni 1920 (VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446), sowie oben, S. 95 f.
65
was zweierlei bedeuten kann: zum einen, daß kein Weber-eigener Titel vorlag oder – zum anderen –, daß Marianne Weber und Melchior Palyi die stichwortartigen Angaben durch präzisere Überschriften ersetzen wollten, um der Buchpublikation den provisorischen Charakter zu nehmen. In den Fällen, wo es während der Drucklegung Varianten der Kapitelüberschriften gab, wurde hier auf die von Marianne Weber zuerst genannten Bezeichnungen zurückgegriffen („Bürokratismus“ statt „Bürokratie“, „Feudalismus“ statt „Wirkungen des Patriarchalismus und des Feudalismus“). Trotzdem werfen Titelveränderungen während der Durcklegung Zweifel an der Existenz eines Weber-eigenen Originaltitels auf, so daß diese Titel in eckige Klammern gesetzt wurden. Geänderte oder neu hinzugefügte Überschriften des Editors wurden als Herausgeber-Zusatz gekennzeichnet und ebenfalls in eckige Klammern gestellt. So bei den Texten „Bürokratismus“ und „Feudalismus“, vgl. dazu die Editorische Berichte, unten, S. 155 f. und 378 f.
Ob auch die uns überlieferten Zwischenüberschriften von den Erstherausgebern eingefügt worden sind, ist unklar. Im hier bearbeiteten Textbestand weist nur der erste Text „Herrschaft“ drei Zwischenüberschriften auf, bei allen weiteren Texten fehlt eine Untergliederung in eigens betitelte Unterabschnitte. Im Vergleich zu den untergliederten Texten der 1921/22 veröffentlichten zweiten und dritten Lieferung von „Wirtschaft und Gesellschaft“ ist dies ein auffälliger Befund. Wenn man annimmt, daß die Zwischenüberschriften weitgehend von Melchior Palyi eingefügt worden sind, kann man folgern, daß deren Fehlen in weiten Teilen der abschließenden vierten Lieferung auf das zunehmende Zerwürfnis zwischen ihm [109]und dem Verlag im Sommer 1922 zurückzuführen ist
66
und dieser dann eine solche zeitaufwendige Unterteilung der Texte nicht mehr vorgenommen hat. Gegen diese Annahme spricht jedoch, daß für alle Texte der vierten Lieferung, einschließlich des letzten Textes „Staat und Hierokratie“, aufwendige Kapitelübersichten erstellt worden sind. Ihre Erarbeitung fiel hauptsächlich in das Ressort von Palyi, wie aus einem Brief von Marianne Weber hervorgeht.[109] Vgl. dazu die Ausführungen, oben, S. 98 f.
67
Er hätte – legt man eine logische Abfolge der Arbeitsschritte zugrunde – direkt bei der Erstellung der Inhaltsangaben Zwischentitel in die Texte einfügen können. Daß im vorliegenden Fall nur der „Herrschafts“-Text eine Untergliederung mit Zwischenüberschriften aufweist, könnte indessen ein Hinweis auf seine weitgehende Überarbeitung und Fertigstellung durch Max Weber selbst sein, der – wie ein Blick in die Originalmanuskripte zeigt – Zwischenüberschriften häufig erst nachträglich in den laufenden Text einfügte. Marianne Weber schrieb am 22. Juni 1921 an Oskar Siebeck: „In die Fahnenrevision müssen nun die Inhaltsangaben der Kapitel] die M[ax] W[eber] nur für die Rechtssoziol[ogie] gemacht hat, hineingearbeitet werden. Ich werde mich mit Dr. P[alyi] in diese Arbeit teilen, v[oraus]s[ichtlich] zunächst die Stichworte entwerfen u. ihm vorlegen." (VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München. Ana 446).
68
Da der Text „Herrschaft“ eine inhaltliche Dreiteilung aufweist, werden die überlieferten Zwischenüberschriften hier übernommen, allerdings ohne Paragraphen-Zählung. Diese wird – in Analogie zum Originalmanuskript von „Die Wirtschaft und die Ordnungen“, So beim 2. und 3. Abschnitt von „Die Wirtschaft und die Ordnungen“, bei den auf den Textseiten oben eingefügten Überschriften zu Weber, Recht §§ 2–6, und ganz offensichtlich bei Weber, Recht § 7, S. 11 (WuG1, S. 494 f.), wo die Überschrift mitten in die laufende Manuskriptseite eingefügt worden ist. Zu den Einzelnachweisen vgl. oben, S. 107 f., Anm. 62.
69
aber auch zu dem im Teilband „Religiöse Gemeinschaften“ gewählten Verfahren Dieser relativ kurze Text hat ebenfalls drei Zwischenüberschriften mit arabischer Zählung von Max Webers Hand. Vgl. Weber, Die Wirtschaft und die Ordnungen, S. 1, 4 und 14 (WuG1, S. 368, 374, 381).
70
– in arabische Zählung überführt und mit einem text-kritischen Nachweis versehen. Vgl. den Editorischen Bericht zu „Religiöse Gemeinschaften“. MWG I/22-2. S. 106.
71
Vgl. dazu den Editorischen Bericht zum Text „Herrschaft“, unten. S. 124.
Die Bereichsüberschrift „Typen der Herrschaft“, die in der Erstausgabe einen Großteil der nachfolgend edierten Texte umschließt, ist eindeutig eine Hinzufügung der Erstherausgeber. Nachdem die Neufassung von „Wirtschaft und Gesellschaft“ als erster Teil erschienen war, hatten sich Marianne Weber und der Verlag für eine Unterteilung der nachgelassenen Texte zu „Wirtschaft und Gesellschaft“ entschieden. Sie suchten daher nach passenden Titeln für den zweiten und dritten Teil und einigten sich [110]auf „Typen der Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung“ und „Typen der Herrschaft“,
72
wobei der letztgenannte Titel von Marianne Weber vermutlich entsprechend der Überschrift zum dritten Kapitel der ersten Lieferung gewählt wurde, um so die beiden verschiedenen Fassungen von „Wirtschaft und Gesellschaft“ eng miteinander zu verknüpfen. Von der Max Weber-Gesamtausgabe wird der Bereichstitel aus den genannten Gründen nicht übernommen. Zur Bezeichnung des Textbestandes dient nun der Titel „Herrschaft“. [110] Vgl. insbes. den Brief von Marianne Weber an Oskar Siebeck vom 20. Okt. 1921 (VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446).
Einige Besonderheiten im Umgang mit Emendationen und Sacherläuterungen ergeben sich aus dem bereits beschriebenen Umstand, daß es sich bei den nachfolgend edierten Texten um nachgelassene, von Max Weber nicht zum Druck freigegebene Texte handelt. Ein Teil der Emendationen betrifft die den Erstherausgebern eindeutig zuzuschreibenden redaktionellen Eingriffe, die zu einer gewissen formalen Vereinheitlichung der Textpräsentation geführt haben. Dazu zählen die Einfügung von Inhaltsübersichten zu den einzelnen Texten, die durchgängige Paragraphen-Zählung bei Zwischentiteln sowie die erläuternden Anmerkungen der Herausgeber. Wie Marianne Weber im Vorwort zur zweiten Lieferung angab, lagen Inhaltsübersichten nur für die „Rechtssoziologie“ vor.
73
Die überlieferten Inhaltsübersichten zu den Herrschaftstexten sind somit zweifelsfrei Hinzufügungen der Erstherausgeber und werden von der Edition daher nicht als Textbestandteil wiedergegeben. An den entsprechenden Textstellen erfolgt jedoch ein Hinweis im textkritischen Apparat. Weber, Marianne, Vorwort [vom Oktober 1921], in: WuG1, S. III. Diese Aussage wird durch ihren Brief an Oskar Siebeck vom 22. Juni 1921 (VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446) und den Fund des Originalmanuskripts bestätigt. Zur „Rechtssoziologie“ liegen Inhalts- und Seitenübersichten von der Hand Max Webers zu Recht §§ 1–6 vor; vgl. dazu oben, S. 107 f., Anm.62.
74
Die einheitliche Verwendung der Paragraphen-Zählung, ebenso wie die Hinzufügung der Kapitelübersichten, dürften die Erstherausgeber nach dem Vorbild der von Max Weber zum Druck vorbereiteten „Rechtssoziologie“ vorgenommen haben. Vgl. unten, S. 157, textkritische Anm.a, S. 248, textkritische Anm.a, S. 380, textkritische Anm. a, S. 460, textkritische Anm. a, S. 481, textkritische Anm. a, S. 542, textkritische Anm. a, S. 579, textkritische Anm. a.
75
Die Zählung nach Paragraphen wird im hier vorliegenden Fall – wie bereits erwähnt – rückgängig gemacht. An einigen Stellen fügten die Erstherausgeber Fußnoten an, die sich zumeist auf Ver[111]weisauflösungen bezogen oder Datierungshilfen gaben. Eine mehrfach wiederkehrende Bemerkung lautete „Vor dem Weltkrieg geschrieben“. Eine Paragraphen-Zählung findet sich zu Weber, Recht §§ 1–7, Inhaltsübersichten jedoch nur zu Recht §§ 1–6; vgl. dazu oben, S. 107 f., Anm. 62.
76
Sie trug den veränderten politischen Bedingungen nach 1918 Rechnung und war als didaktischer Hinweis an die Leser der zwanziger Jahre gerichtet. Hilfen zur Verweisauflösung gaben sie nicht an allen Stellen, sondern zumeist nur dort, wo Irritationen bezüglich der Kapitelanordnung hätten auftreten können.[111] Z. B. unten, S. 168, textkritische Anm. i, S. 135, textkritische Anm. o („Vor 1914 geschrieben“), S. 512, textkritische Anm. x („1912“).
77
Die Funktion der damaligen Herausgeber-Anmerkungen bestand also eindeutig darin, die Plausibilität von Webers eigenen Äußerungen, aber auch die der Herausgeber-Entscheidungen zu erhöhen. In der hier vorgelegten Edition werden sie im textkritischen Apparat wiedergegeben und – wo es sachlich geboten scheint – in die Kommentierung miteinbezogen. So z. B. an den Stellen, wo mangels einer Bezugsstelle in der älteren Fassung des Manuskripts auf die ersten Lieferung verwiesen wurde (unten, S. 142, textkritische Anm. u, und S. 542, textkritische Anm. b), oder wo die Verweisrichtung nicht stimmte (vgl. unten, S. 278, textkritische Anm. z, S. 289, textkritische Anm. c) oder es Unsicherheiten gab, ob sich überhaupt ein Bezug im Band hätte finden lassen können (vgl. unten, S. 161, textkritische Anm. e, S. 252, textkritische Anm. f, S. 298, textkritische Anm. k, S. 469, textkritische Anm. h), und schließlich der Hinweis auf nicht eingelöste Schreibabsichten (unten, S. 413, textkritische Anm. I, und WuG1, S. 787, vgl. dazu den Editorischen Bericht zu „Staat und Hierokratie“, unten, S. 578, Anm. 78).
Ein anderer Teil der Emendationen betrifft Verschreibungen,
78
die sich durch die besondere Überlieferungslage der Texte erklären lassen. Entsprechend der überlieferten Originalmanuskripte zum Bereich „Recht“ und des zur „Herrschaftssoziologie“ gehörenden sechsseitigen Originalmanuskripts darf man vermuten, daß ein beträchtlicher Teil des hier edierten Textbestandes handschriftlich verfaßt war und somit Entzifferungsprobleme mit sich brachte. In die textkritische Überprüfung der hier vorliegenden Edition wurden die Arbeiten von Otto Hintze und Johannes Winckelmann miteinbezogen: an den entsprechenden Stellen wurde jedoch auf einen Einzelnachweis verzichtet. Otto Hintze hatte im Zuge seiner Besprechung der 2. Auflage von „Wirtschaft und Gesellschaft“ eine Korrigendaliste erstellt (vgl. Hintze, Webers Soziologie (wie oben, S. 35, Anm. 36), S.88). Johannes Winckelmann nahm in den beiden von ihm herausgegebenen Auflagen von „Wirtschaft und Gesellschaft“ – in der Regel ohne Einzelnachweis – Korrekturen und Änderungen am Textbestand vor (vgl. Weber, Max, Wirtschaft und Gesellschaft, Grundriß der verstehenden Soziologie, 4. Aufl., hg. von Johannes Winckelmann. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1956, S. 541–550, 559–734, und dass., 5. Aufl., ebd., 1972, S. 541–726). Eine Zusammenstellung der von Winckelmann übernommenen bzw. selbst vorgenommenen Textberichtigungen seit der 1. Auflage findet sich im Anhang zur 4. Auflage von „Wirtschaft und Gesellschaft“ (S. 929–948).
79
Für diese Annahme spricht auch, daß ein Großteil [112]der hier vorgenommenen Emendationen auf Lesefehlern beruht. Offensichtliche Hörfehler, die bei Diktaten entstehen können, finden sich gehäuft nur in einem Text. Vgl. den Faksimile-Abdruck, unten, S. 682 und 693.
80
Im Vergleich mit den von Max Weber selbst korrigierten und autorisierten Texten gibt es daher bei den postum veröffentlichten Texten mehr Unsicherheiten, was die Lesung betrifft, zumal die Manuskripte und Druckfahnen – wie schon erwähnt – durch mehrere Hände gegangen sind und heute zum größten Teil als verloren gelten. Ein Vergleich zwischen den überlieferten Originalmanuskripten und der gedruckten Fassung von „Wirtschaft und Gesellschaft“ ergibt eine Häufung von Unsicherheiten und Abweichungen an schwer entzifferbaren Stellen. Dies betrifft vor allem außergewöhnliche, fremdsprachliche Ausdrücke und Eigennamen.[112] Vgl. den Editorischen Bericht zum Text „Umbildung des Charisma“, unten, S. 479 f.
81
Die hier vorgelegte Edition hat daher neben dem sonst üblichen textkritischen Verfahren auch Emendationen vorgenommen, die sich durch einen Vergleich mit Schreibweisen und Sachangaben in anderen, von Max Weber selbst autorisierten Texten Z. B. „Gudea’s“ statt „Sutra’s“ (unten, S. 593), „mahdistischen“ statt „methodistischen“ (unten, S. 609).
82
oder durch den Vergleich mit den von ihm offensichtlich herangezogenen Literaturvorlagen ergeben haben. Im Text „Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft“ kommt der Ausdruck „außerwerktäglich“ bzw. „unwerktäglich" vor, der in den von Weber autorisierten Texten nicht belegt ist; in ihnen findet sich das Weber-spezifische „außeralltäglich“. Vgl. dazu den Editorischen Bericht, unten, S. 725. An Einzelbeispielen: Emendation von „tretyj element“ (unten, S. 162, textkritische Anm. f), „Mjeschtschitelstwo“ (unten, S. 204, textkritische Anm. r), „ad notam amovible“ (unten, S. 306, textkritische Anm. x), „ligurischen Inseln“ (unten, S. 487, textkritische Anm. g), Josua (unten, S. 522, textkritische Anm. m).
83
Durch dieses Verfahren ist die Textüberlieferung behutsam von möglichen Eingriffen der Erstherausgeber befreit worden. Dies betrifft vor allem die Schreibweise von arabischen Begriffen, vgl. unten, S. 391–393, die dort nach der benutzten Aufsatzvorlage von Carl Heinrich Becker korrigiert wurden. Vgl. dazu auch die Editorischen Berichte zu den Texten „Patrimonialismus“ und „Feudalismus“, unten, S. 246 und 379.
Ein vergleichbares Verfahren wurde auch bei der Sachkommentierung angewendet. Max Weber hat in seinem Beitrag „Wirtschaft und Gesellschaft“ auf bibliographische Nachweise weitgehend verzichtet. Nur wenige Autoren werden namentlich genannt, konkrete Werktitel nur in Ausnahmefällen angegeben. Für die Nachweisung der von Max Weber zitierten Literatur gab es deshalb im überlieferten Textbestand nur sehr wenige Anhaltspunkte. Zur Erläuterung der erklärungsbedürftigen Sachverhalte wurden daher aus der zeitgenössischen Literatur diejenigen Schriften herangezogen, die Weber benutzt haben könnte. Es ist aber nicht beab[113]sichtigt, auf diese Weise den bei Max Weber nicht vorhandenen Anmerkungsapparat zu ersetzen. In einer Reihe von Fällen konnte sich die Kommentierung auf ältere oder parallel verfaßte Texte Max Webers stützen, in denen vergleichbare Sachaussagen – teilweise in präziserer Form, oft auch unter Hinzufügung detaillierter Literaturangaben, – dargelegt worden sind. Wo diese Parallelität eindeutig gegeben und der Sachkommentierung dienlich war, wurde die entsprechende Literatur zur Kommentierung herangezogen und mit einem Hinweis auf die andere Werkstelle versehen. Mithilfe dieses Verfahrens konnte die Literaturauswahl objektiviert und zugleich der Nebeneffekt erzielt werden, daß werkbiographische Zusammenhänge sehr plastisch zutage treten. Die Kommentierung stützt sich vorrangig auf zeitgenössische, möglichst von Weber selbst herangezogene Literatur. Trotzdem gab es eine Reihe von Fällen, wo auf spätere Literatur und Forschungsarbeiten zurückgegriffen werden mußte, denn ein Teil von Webers Informationen dürfte auch auf mündliche Berichte von Kollegen oder auf aktuelle Berichterstattung durch die Tagespresse zurückzuführen sein. Die in den Literaturangaben erwähnten Jahreszahlen sollten daher nicht zwangsläufig mit dem möglichen Entstehungskontext der hier edierten Texte in eins gesetzt werden. Bibelzitate und -stellen wurden mit der um die Jahrhundertwende gebräuchlichen Luther-Bibel belegt.
84
[113] Vgl. Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments, nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers. – Berlin: o.V. 1899.
Zur Zeit Max Webers gab es in den europäischen Wissenschaften für die meisten außereuropäischen Sprachen noch keine verbindlichen Regelungen zur Transkription bzw. Transliteration. Die Schreibungen Webers für diese Sprachen sind daher nicht einheitlich. Sie werden beibehalten, falls sie nicht nachweislich fehlerhaft sind. In der Herausgeberrede erfolgt die Umschrift nach heutigen wissenschaftlichen Standards. Griechisch wird (ohne Akzente) in lateinischen Buchstaben wiedergegeben. Für das Arabische folgt die Umschrift den Empfehlungen der „Deutschen Morgenländischen Gesellschaft“ aus den 1930er Jahren, die zum Teil schon in der ersten Auflage der „Enzyklopädie des Islam“ angewendet wurden.
85
Japanische Namen und Wörter werden nach dem Hepburn-System umschrieben. Der erste Band der deutschsprachigen Ausgabe der „Enzyklopädie des Islam“ erschien bereits 1913, der abschließende vierte Band erst 1936.
86
Die Transkription des Chinesischen, Nach Hadamitzky, Wolfgang, Langenscheidts Lehrbuch und Lexikon der japanischen Schrift. – Berlin, München u. a.: Langenscheidt 1980, S. 11 f.
87
die Translite[114]ration der indischen Sprachen Vgl. MWG 1/19, S. 523 (modifizierte Wade-Giles-Umschrift).
88
sowie des Russischen[114] Vgl. MWG I/20, S. 43 f., 46 f., 544.
89
erfolgt in Anlehnung an die bereits erschienenen Bände der Max Weber-Gesamtausgabe nach den dort verwendeten Systemen. Vgl. MWG I/10, S. 52.
Die in der Herausgeberrede angeführten Datierungen zur außereuropäischen Geschichte stützen sich, falls nicht anders angegeben, für die ägyptische Geschichte auf eine neubearbeitete Chronologie von Jürgen von Beckerath,
90
für die chinesische Geschichte auf eine Dynastientafel, die Helwig Schmidt-Glintzer im Anhang zur Einleitung zu den Konfuzianismus- und Taoismus-Studien Max Webers veröffentlicht hat Beckerath, Jürgen von, Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr. (Münchner Ägyptologische Studien, Band 46). – Mainz: Philipp von Zabern 1997.
91
und für die japanische Geschichte auf eine von John Whitney Hall erstellte Zeittafel. Vgl. Schmidt-Glintzer, Helwig, Einleitung, MWG I/19, S. 26 f.
92
In der Regel werden alle zeitlichen Angaben nach dem bei uns gültigen Gregorianischen Kalender wiedergegeben. Das betrifft insbesondere die Angaben zur islamischen, russischen und französischen Revolutionsgeschichte. Hall, John Whitney, Das Japanische Kaiserreich (Fischer Weltgeschichte, Band 20). – Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag 1990, S. 356–359 (hinfort: Hall, Japanisches Kaiserreich).