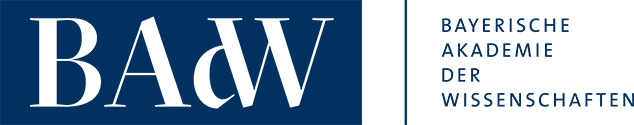[1]Einleitung
1. Das Interesse an den Weltreligionen am Vorabend des Ersten Weltkriegs und das Problem der Wirtschaftsethik
Max Webers Arbeiten zur „Wirtschaftsethik der Weltreligionen“ müssen einerseits in ihrem werkgeschichtlichen Zusammenhang gesehen werden,
1
sie lassen sich aber andererseits nur verstehen vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen und politischen Strömungen jenes „Zeitalters des Imperialismus“, innerhalb derer Max Weber dezidierte eigene Positionen eingenommen und die er durch neue Einsichten bereichert hat. [1] Siehe hierzu Schluchter, Wolfgang, Max Webers Religionssoziologie. Eine werkgeschichtliche Rekonstruktion, in: ders. (Hg.), Max Webers Sicht des antiken Christentums. Interpretation und Kritik. – Frankfurt am Main: Suhrkamp 1985, S. 525–560 [hinfort zitiert als: Schluchter, Rekonstruktion]; siehe auch unten, S. 31–60.
Vorbereitet durch die Romantik und die Anerkennung anderer Völker und ihrer Religionen als Erscheinungen eigenen Rechts und eigenen Wertes hatte in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts die Verunsicherung über die Gewißheit der eigenen abendländischen Kultur und ihrer Entwicklungsrichtung zu einer Relativierung aller religiösen Erscheinungen und schließlich zur Herausbildung derjenigen theologisch-religionswissenschaftlichen Bewegung geführt, die als „Religionsgeschichtliche Schule“ auftrat und der Max Weber nahestand.
2
Die Horizonte hatten sich wohl auch infolge der Expansion der europäischen Mächte im späten neunzehnten Jahrhundert erweitert, und die Geschichte außereuropäischer Völker und ihre Religionen wurden als Teil der Kultur der Gegenwart und nicht mehr als außerhalb der Weltgeschichte stehend betrachtet. Dabei war China nicht erst seit G. W. F. Hegels „Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte“ Siehe den Artikel von Martin Rade: „Religionsgeschichte und Religionsgeschichtliche Schule“, in: RGG1 Band 4, 1913, Sp. 2183–2200; zu diesem Zusammenhang auch W. R. Ward, Max Weber und die Schule Albrecht Ritschls, in: Mommsen, Wolfgang J., und Schwentker, Wolfgang (Hg.), Max Weber und seine Zeitgenossen. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1988, S. 296–312; sowie Graf, Friedrich Wilhelm, Fachmenschenfreundschaft. Bemerkungen zu ,Max Weber und Ernst Troeltsch‘, ebd., S. 313–336.
3
in ganz besonderem Maße in das allgemeine Bewußtsein gedrungen. Bereits seit dem 17. Jahrhundert, gefördert vor allem durch die von den jesuitischen Missionaren in Europa über China verbreiteten Nachrichten [2]und Kenntnisse, galt China als das Gegenbild zu Europa, als der aufgeklärte Staat mit einer vorbildlichen Staatsweisheit und Herrschaftsausübung. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Werke in zwanzig Bänden, Band 12: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. – Frankfurt am Main: Suhrkamp 1970.
4
Auch wenn sich das Chinabild insbesondere seit dem Opiumkrieg 1840–42 und nicht zuletzt infolge eines neuen Selbstverständnisses in Europa veränderte, stand China doch auch weiterhin zumeist am Anfang der Darstellungen außereuropäischer Kulturen, so auch in der aus dem Französischen übersetzten Reihe „Welt-Gemälde-Gallerie“.[2] Siehe Reichwein, Adolf, China und Europa. Geistige und künstlerische Beziehungen im 18. Jahrhundert. – Berlin: Österheld 1923; Dawson, Raymond, The Chinese Chameleon. An Analysis of European Conceptions of Chinese Civilization. – London: Oxford University Press 1967; Lach, Donald F., Asia in the Making of Europe, 5 Bände. – Chicago: Chicago University Press 1965–1970; Hudson, Geoffrey F., Europe and China. A Survey of their Relations from the Earliest Times to 1800. – Boston: Beacon 1961; Fu, Lo-shu, A Documentary Chronicle of Sino-Western Relations (1644–1820), 2 Bände. – Tucson, Arizona: University of Arizona Press 1966; Berliner Festspiele GmbH (Hg.), Europa und die Kaiser von China 1240–1816. – Frankfurt am Main: Insel 1985; Walravens, Hartmut, China illustrata. Das europäische Chinaverständnis im Spiegel des 16. bis 18. Jahrhunderts. – Weinheim: Acta Humaniora 1987; Wolff, Christian, Oratio de Sinarum philosophia practica. Rede über die praktische Philosophie der Chinesen, hg. von Michael Albrecht. – Hamburg: Meiner 1985.
5
Welt-Gemälde-Gallerie oder Geschichte und Beschreibung der Länder und Völker. Asien, 1. Band: Μ. G. Pauthier, China. – Stuttgart: Schweizerbart 1839.
Die Ausdehnung der Horizonte und das Näherrücken bis dahin ferner Länder und Kulturen sowie eine allgemeine Tendenz zu systematisierender und verallgemeinernder Betrachtungsweise führten zur Berücksichtigung außereuropäischer Erscheinungen in sämtlichen Wissenschaftszweigen, darunter vor allem in den systematisierenden Disziplinen.
6
In diesem geistigen Klima hatte sich unter einigen jüngeren protestantischen Theologen, aus denen dann die „Religionsgeschichtliche Schule“ hervorgehen sollte, in den 1880er Jahren die Überzeugung herausgebildet, daß infolge der Erkenntnisse der historischen Forschung eine strenge Trennung zwischen Christentum und nicht-christlichen Religionen nicht mehr aufrechtzuerhalten sei. So rief Martin Rade (1857–1940), der 1886 die Zeitschrift „Die christliche Welt“ begründet hatte und seither ihr Herausgeber war, bereits in jener Zeit zur Errichtung neuer Lehrstühle für Religionsgeschichte auf. Daraus entstand ein Konflikt innerhalb der Theologie, der um die Jahrhundertwende auch im Streit um die religionsgeschichtliche Methode einen Ausdruck fand. Diese Entwicklung fand ihren Niederschlag auch im Bereich der Literatur, wo man von einer „Ostasien-Begeisterung“ gesprochen hat. Siehe Schuster, Ingrid, China und Japan in der deutschen Literatur 1890–1925. – Bern, München: Francke 1977; ferner Günther, Christiane C., Aufbruch nach Asien. Kulturelle Fremde in der deutschen Literatur um 1900. – München: Iudicium 1988.
Einer der Wortführer war in diesem von Anhängern der Religionsgeschichtlichen Schule entfachten Disput Adolf Harnack, der sich am 3. Au[3]gust 1901 in einer Rektoratsrede mit „ringsum laut gewordenen Stimmen“ auseinandersetzte, die mit der Forderung an die Theologische Fakultät aufträten, „nicht als Facultät für christliche Theologie, sondern nur als Facultät für allgemeine Religionswissenschaft und -geschichte habe sie ein Recht auf Existenz. Nur in dem Maße als sie gleichmäßig auf alle Religionen eingehe, könne sie die eine Religion wirklich verstehen, und nur so könne sie Vorurtheile abstreifen, die sonst unbezwinglich seien; mindestens aber sei zu fordern, daß bei jeder theologischen Facultät ein oder mehrere Lehrstühle für allgemeine Religionsgeschichte errichtet werden.“
7
Dagegen wandte sich Harnack, indem er feststellte, „daß die Völker, welche die Erde jetzt auftheilen, mit der christlichen Civilisation stehen und fallen, und daß die Zukunft keine andere neben ihr dulden“ werde, und zugleich einräumte, daß es für die Verkündigung des Evangeliums eine unerläßliche Vorbedingung zu sein scheine, daß die Christen „die Religionen der fremden Völker gründlich kennen lernen“.[3] Harnack, Adolf, Die Aufgabe der theologischen Facultäten und die allgemeine Religionsgeschichte. – Gießen: Ricker 1901, S. 6 f.; zum Zusammenhang siehe auch RGG1, Band 4, 1913, Sp. 2183 ff.
8
Gleichwohl müsse man die jüdisch-christliche Religion als einzigartiges Paradigma von Religion überhaupt bezeichnen, als diejenige Religion, die allein Geschichte gehabt habe. Und unter Anspielung auf Max Müllers (1823–1900) Wort: „Wer eine kennt, kennt keine“, sagte Harnack: „Wer diese Religion nicht kennt, kennt keine, und wer sie sammt ihrer Geschichte kennt, kennt alle.“ Dass., S. 9.
9
Wie sollte es da, angesichts des Umfangs und der Fülle innerhalb der christlichen Kirchengeschichte, „den Kirchenhistoriker, auch wenn er für die Religion im weitesten Sinn des Worts lebendiges Interesse hat, locken, sich zu den Babyloniern, Indern und Chinesen oder gar zu den Negern oder Papuas zu begeben?“ Dass., S. 11.
10
Harnack hielt es gleichwohl für wünschenswert, daß „kein Theologe die Universität verläßt, ohne eine gewisse Kenntnis mindestens einer außerchristlichen Religion“. Dass., S. 14.
11
Ansonsten solle das Studium anderer Religionen den einzelnen Philologien überlassen bleiben: „Um so lebhafter aber ist unser Wunsch, daß der Indologe, der Arabist, der Sinologe etc. auch der Religion des Volkes, dem er sein Studium gewidmet hat, volle Beachtung schenke und die Ergebnisse seiner Arbeit in Vorlesungen und Büchern mittheile.“ Dass., S. 21.
12
Dass., S. 21.
Trotz dieser seiner eigenen geradewegs entgegengesetzten Position bezeichnete Martin Rade Adolf Harnack im Jahre 1913 neben dem Alttesta[4]mentler Julius Wellhausen als „unfreiwilligen Schöpfer der religionswissenschaftlichen Schule“,
13
der übrigens bei der Berufung eines Religionshistorikers, des Dänen Edvard Lehmann, auf einen Berliner theologischen Lehrstuhl im Jahre 1910 mitgewirkt habe.[4] RGG1, Bd. 4, 1913, Sp. 2191.
14
So hatte, wenn auch später als in den meisten anderen nord- und westeuropäischen Ländern, die Religionsgeschichte schließlich doch Eingang auch an den deutschen Theologischen Fakultäten gefunden, die sich damit zumindest bis zu einem gewissen Grade einer allgemein verbreiteten Betrachtungsweise öffneten, bei der die Kenntnisse ferner und fernster Kulturerscheinungen in die allgemeine systematische Diskussion einbezogen wurden, wie etwa der melanesische Begriff „Mana“, der in der vergleichenden Religionswissenschaft noch über Jahrzehnte die Diskussion über die Existenz der Vorstellung von einer unpersönlichen, übernatürlichen Macht bestimmen sollte und den auch Weber verwendete. RGG1, Bd. 4, 1913, Sp. 2186.
15
Siehe unten, S. 175; vgl. auch die Darstellung bei Widengren, Geo, Evolutionism and the Problem of the Origin of Religion, in: Ethnos 10, 1945, S. 72–96 (auszugsweise auch in deutscher Übersetzung in: Lanczkowski, Günter (Hg.), Selbstverständnis und Wesen der Religionswissenschaft. – Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft 1974, S. 87–113). Eine zusammenfassende Darstellung mit ausführlicher Bibliographie findet sich bei Elsas, Christoph (Hg.), Religion. Ein Jahrhundert theologischer, philosophischer, soziologischer und psychologischer Interpretationsansätze. – München: Chr. Kaiser 1975.
Die Entwicklung hin zu einer stärker systematisierenden Betrachtungsweise, mit der man nicht nur der zunehmenden Vielfalt der Erscheinungen Herr zu werden suchte, sondern die überhaupt erst eine Voraussetzung für die Erweiterung geistiger Horizonte schuf und die zur Begründung einer ganzen Reihe neuer Wissenschaftsdisziplinen führte, läßt sich ebenso wie in der Theologie auch in anderen Disziplinen wie etwa der Geschichte nachweisen. In der ersten Auflage der „Geschichte des Altertums“ von Eduard Meyer findet China nur eine kurze Erwähnung. In dem im Jahre 1893 erschienenen zweiten Band seines Hauptwerkes schreibt Meyer unter dem Abschnitt „Orient und Occident“, in einer an Georg Wilhelm Friedrich Hegels Ausführungen über China in seinen „Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte“ erinnernden Formulierung: „Die Geschichte des Orients beginnt mit ausgereiften Kulturvölkern. Die geschichtlichen Denkmäler, welche diese geschaffen haben, bilden den Anfang des historischen Wissens überhaupt; wie sie diese Höhe erreicht haben, wie im Nilthal, am unteren Euphrat und ebenso am Hwangho menschliche Kultur zuerst entstanden ist, bleibt der geschichtlichen Erkenntnis verschlossen.“
16
Meyer, Eduard, Geschichte des Alterthums, 2. Band. – Stuttgart: J. G. Cotta 1893, S. 33.
[5]Seitdem aber hatte sich doch allmählich die Einsicht durchgesetzt, daß keines der Kulturgebiete der Erde bei einer Gesamtdarstellung fehlen dürfe. Und wie sehr China bereits als Teil der Weltkultur angesehen wurde, läßt sich an den zahlreichen Handbüchern und Nachschlagewerken ablesen, die seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert erschienen. Zudem erzwang das Bedürfnis nach umfassender und systematischer Betrachtung eine Einbeziehung auch bis dahin unberücksichtigter Erscheinungen; und die Erweiterung der Horizonte legte ihrerseits eine systematische Betrachtungsweise nahe. Der Tendenz zur Typisierung, die sich überhaupt in vielfältiger Ausprägung in nahezu allen Bereichen zeigte, konnte sich auch Eduard Meyer nicht entziehen, der 1907 in der zweiten Auflage seines Hauptwerkes „Geschichte des Altertums“ mit dem ersten Halbband eine „Einleitung“ vorlegte, die den Untertitel „Elemente der Anthropologie“ trug.
17
Darin wird gelegentlich auch China genannt, insbesondere in vergleichender Absicht zusammen mit Ägypten, Babylonien und anderen alten Kulturen. [5] Meyer, Eduard, Geschichte des Altertums, Band 1.1, 2. Aufl. – Stuttgart: J. G. Cotta 1907.
Dieser umfassenden Kulturbetrachtung schließt sich Paul Hinneberg in seinem großen Sammelwerk „Kultur der Gegenwart. Ihre Entwicklung und ihre Ziele“
18
an, das in mehreren seiner Abteilungen auch China berücksichtigt. In der der „Allgemeinen Geschichte der Philosophie“ gewidmeten Abteilung ist die „Orientalische (Ostasiatische) Philosophie“ dem Teil „Die europäische Philosophie und die islamische und jüdische Philosophie des Mittelalters“ vorangestellt. Erschienen im Verlag von B. G. Teubner, Berlin und Leipzig.
19
Und ähnlich ist die Abfolge der Darstellung der „Allgemeinen Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte“. Die Kultur der Gegenwart. Ihre Entwicklung und ihre Ziele, hg. von Paul Hinneberg, Teil I, Abt. V. – Leipzig, Berlin: B. G. Teubner 1909.
20
In der den „außerchristlichen Religionen“ gewidmeten Abteilung folgen auf die Kapitel über „Die Anfänge der Religion und die Religion der primitiven Völker“ und über „Die ägyptische Religion“ die „asiatischen Religionen“, und zwar die babylonisch-assyrische, die indische, die iranische, sodann die Religion des Islams, der Lamaismus, die Religionen der Chinesen und der Japaner. Dass., Teil II, Abteilung II,1: Allgemeine Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte, Erste Hälfte, 1911.
21
Dass., Teil I, Abt. lll, 3: Die Religionen des Orients und die altgermanische Religion, 21913.
Bei der Behandlung der Religionen mit China zu beginnen und dann über Indien und den Islam zum Judentum und Christentum fortzuschreiten, entsprach weit verbreitetem Brauch. So hatte schon Georg Wilhelm Fried[6]rich Hegel in seinen „Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte“ mit der „orientalischen Welt“ und dabei mit China, auf das dann Indien folgt, begonnen.
22
Auch Pierre Daniel Chantepie de la Saussaye stellt in allen Auflagen des von ihm herausgegebenen „Lehrbuchs der Religionsgeschichte“ China an den Beginn des historischen Teils, dem nur die Behandlung der „sogenannten Naturvölker“ vorangeht.[6] Die gleiche Abfolge findet sich in seinen „Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie“.
23
Chantepie de la Saussaye, Pierre Daniël, Lehrbuch der Religionsgeschichte, 2 Bände. – Freiburg i. Brsg.: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1887, 1888. – dass., 2. völlig neu gearbeitete Aufl., 2 Bände. – Freiburg i. Brsg., Leipzig: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1897. – dass., 3., vollständig neu bearbeitete Aufl., 2 Bände. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1905. – Auch Max Müller hatte in seinem Stammbaum der Religionen die turanische Religion, worunter er die vielfältigen Religionsformen der eurasischen Landmasse verstand, mit dem Zentrum in China an die erste Stelle gesetzt. Ihm erschien die Geschichte der Religionen als ein unbewußtes Fortschreiten zum Christentum.
Wenn Max Weber die von ihm gewählte Reihenfolge seiner Studien zur „Wirtschaftsethik der Weltreligionen“ mit „inneren Zweckmäßigkeitsgründen der Darstellung“
24
begründet und betont, daß damit keine Werthierarchie impliziert sein solle, Über die Abfolge seiner Aufsätze sagt Weber: „Die Reihenfolge der Betrachtung ist – um auch das zu bemerken – nur zufällig geographisch, von Ost nach West gehend. In Wahrheit ist nicht diese äußere örtliche Verteilung, sondern sind, wie sich vielleicht bei näherer Betrachtung zeigt, innere Zweckmäßigkeitsgründe der Darstellung dafür maßgebend gewesen.“ Siehe unten, S. 119, Anm. 3.
25
so ist die Reihenfolge offenbar doch auch nicht zufällig. Schon die Tradition, China an erster Stelle zu nennen, Daraus erklärt sich wohl, daß Weber in der „Einleitung“ betont, er wolle „die wichtigsten der großen Religionen individuell betrachten“. Siehe unten, S. 116.
26
legte es nahe, die Studien mit China zu beginnen, doch meinte Weber mit den „inneren Zweckmäßigkeitsgründen der Darstellung“ auch den Umstand, der sich dann auch in seiner Begriffsreihe niederschlug, daß der, wie Weber es sah, weltbejahende Konfuzianismus im „stärksten Gegensatz“ stand einerseits zum Puritanismus Unter den Sprachwissenschaften, die als Hilfswissenschaften der Religionsgeschichte angesehen werden, wird von Vertretern der Religionsgeschichtlichen Schule selbst an erster Stelle die Sinologie genannt, die „eine Frucht jesuitischer Missionsarbeit in China“ sei. Und von jener ersten Berührung mit dem Konfuzianismus heißt es, sie habe genügt, „daß schon im Deismus und besonders bei Voltaire die 300 Millionen Chinesen mit ihrer rein moralischen Religion der Christenheit eine siegreiche Konkurrenz machten.“ Siehe Martin Rade in: RGG1, Band 4, 1913, Sp. 2194.
27
und andererseits zur weltverneinenden religiösen Ethik, wie sie sich in der indischen Religiosität entwickelt hatte. Siehe unten, S. 451.
28
Daraus erklärt sich auch die in Aufzählungen immer wiederkehrende feste Folge, der auch eine Begriffsreihe entspricht, wie sie sich unter anderem in [7]der für sein Projekt der „Wirtschaftsethik der Weltreligionen“ programmatischen Passage in „Wirtschaft und Gesellschaft“ findet: Siehe unten, S. 479.
„Will man die Schichten, welche Träger und Propagatoren der sog. Weltreligionen waren, schlagwörtlich zusammenfassen, so sind dies für den Konfuzianismus der weltordnende Bürokrat, für den Hinduismus der weltordnende Magier, für den Buddhismus der weltdurchwandernde Bettelmönch, für den Islam der weltunterwerfende Krieger, für das Judentum der wandernde Händler, für das Christentum aber der wandernde Handwerksbursche, sie alle nicht als Exponenten ihres Berufes oder materieller ‚Klasseninteressen‘, sondern als ideologische Träger einer solchen Ethik oder Erlösungslehre, die sich besonders leicht mit ihrer sozialen Lage vermählte.“
29
[7] WuG1, S. 293. [[MWG I/22-2]]
Diese Sequenz von Ost nach West, vom Konfuzianismus über den Hinduismus, den Buddhismus, den Islam und das Judentum zum Christentum, wird in der „Einleitung“ zur „Wirtschaftsethik der Weltreligionen“ wieder aufgenommen, allerdings sehr viel differenzierter und mit erheblichen Abweichungen in den Charakterisierungen der einzelnen Religionen.
30
Siehe unten, S. 86 f.
Obwohl der Begriff der „Weltreligion“ seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts durchaus geläufig war, verwendet Weber ihn doch erst nach anfänglichem Zögern. In der eben zitierten Stelle in dem Abschnitt „Religionssoziologie“ spricht er von „sog. Weltreligionen“ und an anderer Stelle von „Kulturreligionen“,
31
ein Begriff, der ihm selbst näher gelegen zu haben scheint. So erwägt er noch während der Vorbereitungen der Sammelbände der religionssoziologischen Aufsätze den Titel „Gesammelte Aufsätze zur Soziologie der Kulturreligionen“. WuG1, S. 349. [[MWG I/22-2]]
32
in der „Einleitung“, die zuerst 1915 im Druck erschien, aber hatte er bereits formuliert: Brief an Paul Siebeck vom 11. Sept. 1919, VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446. [[MWG II/10]] – Vgl. auch unten, S. 44, sowie Winckelmann, Johannes, Erläuterungsband zu: Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie, fünfte, revidierte Auflage. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1976, S. 85 f.; ders., Max Webers hinterlassenes Hauptwerk. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1986, S. 142; dieser Neigung zum Begriff „Kulturreligion“ entspricht auch die Verwendung des Ausdrucks „Kulturländer" in der „Vorbemerkung“ (Weber, Vorbemerkung, S. 6).
„Unter ,Weltreligionen‘ werden hier, in ganz wertfreier Art, jene fünf religiösen oder religiös bedingten Systeme der Lebensreglementierung verstanden, welche besonders große Mengen von Bekennern um sich zu scharen gewußt haben.“
33
Archiv für Sozialwiss. und Sozialpolitik, Band 41, Heft 1 (September-Heft 1915), S. 1; vgl. unten, S. 83.
[8]Der Ausdruck „Weltreligion“ entstammt der Religionswissenschaft
34
und wurde dort als Entgegensetzung zu dem Begriff „Volksreligion“ gebraucht. Abraham Künen verwendet ihn in seinem Werk „Volksreligion und Weltreligion“,[8] Zu den Begriffen Religionsgeschichte und Religionswissenschaft siehe Hardy, Edmund, Was ist Religionswissenschaft? Ein Beitrag zur Methodik der historischen Religionsforschung, in: Archiv für Religionswiss. 1, 1898, S. 9–42; abgedruckt in: Lanczkowski, Günter (Hg.), Selbstverständnis und Wesen der Religionswissenschaft (Wege der Forschung, Band 263). – Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft 1974, S. 1–29.
35
der Jenaer Orientalist Karl Vollers schrieb ein Buch über „Die Weltreligionen in ihrem geschichtlichen Zusammenhange“ (1907), Künen, Abraham, Volksreligion und Weltreligion. Fünf Hibbert Vorlesungen. – Leiden 1882, dt. Berlin: Reimer 1883.
36
und bei Wilhelm Wundt ist der Begriff bereits etabliert. Vollers, Karl, Die Weltreligionen in ihrem geschichtlichen Zusammenhange. – Jena: Diederichs 1907.
37
Dabei wurde der Ausdruck „Weltreligion“ unterschiedlich und zumeist wertend gebraucht, was schon in der Gegenüberstellung zum Begriff „Volksreligion“ zum Ausdruck kommt. Der Begriff „Kulturreligion“, den Weber auch ins Auge faßte, schien ihm, da er als Gegensatz zu „Naturreligion“ hätte verstanden werden können, jedenfalls nicht geeigneter zu sein, so daß er den Begriff „Weltreligion“ „in ganz wertfreier Art“ verwendete. Siehe Wundt, Wilhelm, Elemente der Völkerpsychologie. Grundlinien einer psychologischen Entwicklungsgeschichte der Menschheit. – Leipzig: Alfred Kröner 1912, der allerdings „nur zwei Weltreligionen im eigentlichsten Sinne dieses Wortes“ anerkennt, nämlich Buddhismus und Christentum. Vgl. ebd., S. 491. – Zum „religionswissenschaftlichen Hintergrund“ allgemein siehe Küenzlen, Gottfried, Unbekannte Quellen der Religionssoziologie Max Webers, in: Zeitschr. für Soziologie, Jg. 7, Heft 3, 1978, 215–227, hier S. 218 ff.; wiederholt in: ders., Die Religionssoziologie Max Webers. Eine Darstellung ihrer Entwicklung. – Berlin: Duncker & Humblot 1980, S. 62 ff.
Die Hinwendung zu anderen Religionen – Friedrich Michael Schiele schreibt im Vorwort zum ersten Band des Handwörterbuchs „Die Religion in Geschichte und Gegenwart“ von „Hauptreligionen“
38
– war in jener Zeit allgemein und bezog für China in erster Linie den Konfuzianismus, aber auch den Taoismus mit ein. So ließ Friedrich Michael Schiele, der seit dem Jahre 1904 die „Religionsgeschichtlichen Volksbücher“ herausgab, in den Jahren 1912 und 1913 in dieser Reihe auch Darstellungen der Lehren des Lao-tzu und des Konfuzius erscheinen. RGG1, Band 1, 1909, S. IX.
39
Die mit ihrer strengen historisch-philologischen Orientierung für die religionswissenschaftliche Forschung jener Zeit symptomatische Zeitschrift „Archiv für Religionswissenschaft“ hatte im Jahre 1910 erstmals einen Bericht über „Die religionswissenschaftliche Literatur über China seit 1900“ von Otto Franke aufgenommen [9]und auch zu anderen asiatischen Ländern Berichte über die religionswissenschaftliche Literatur veröffentlicht. Zu den „Religionsgeschichtlichen Volksbüchern“ siehe den Artikel von Friedrich Michael Schiele in: RGG1, Band 5, 1913, Sp. 1721–1725.
40
[9] Archiv für Religionswissenschaft, Band 13, 1910, S. 111–152. Berichte von A. Wiedemann, Bonn, über die Ägyptische Religion, von H. Haas, Heidelberg, über die Religion der Japaner, von K. Th. Preuß, Berlin, über die Religionen der Naturvölker, von H. Oldenberg, Göttingen, über den indischen Buddhismus und von H. Jacobi, Bonn, über den Jainismus folgten im gleichen Band. Zu einigen dieser Länder sowie über einzelne Bereiche der Religionswissenschaft hatte es in früheren Jahrgängen bereits Berichte gegeben. – Neben dem seit 1900 bestehenden Archiv für Religionswissenschaft waren die anderen wichtigen religionswissenschaftlichen Zeitschriften die Revue de l’histoire des religions, seit 1880, und die seit 1886 erscheinende Zeitschrift für Missionskunde und Religionswissenschaft.
So sehr in vielen der Handbücher und religionswissenschaftlichen Arbeiten auch dem Eigenwert der fremden Religionen Rechnung getragen wurde, blieb doch die Überzeugung von der eigenen Überlegenheit weithin vorherrschend, wie dies auch Adolf Harnack in seiner erwähnten Rektoratsrede unmißverständlich zum Ausdruck gebracht hatte. So heißt es in dem von Heinrich Julius Holtzmann für das Werk „Kultur der Gegenwart“ verfaßten Beitrag „Die Zukunftsaufgaben der Religion und die Religionswissenschaft“: „Hat sich sonach das Christentum bisher fähig erwiesen, sich in den verschiedensten Atmosphären zu akklimatisieren, immer neue Kulturwerte zu verarbeiten, so ist nicht abzusehen, warum bei fortgesetzter Verfolgung dieses Weges das nicht so weitergehen sollte. Das Christentum ist überdies die einzige von allen Weltreligionen, die ihre Grenzen heute noch stets weiter hinausrückt; und was kulturlose Völker im Laufe der beiden letzten Jahrhunderte an zivilisiertem Wesen und humaner Gesittung empfangen haben, verdanken sie fast ausnahmslos der christlichen Propaganda.“
41
Diese Sicht teilten allerdings viele Zeitgenossen nicht; und mit dem Ausbruch des Weltkriegs im Jahre 1914 nahm eine bereits bestehende Europamüdigkeit Die Kultur der Gegenwart. Ihre Entwicklung und ihre Ziele, herausgegeben von Paul Hinneberg, Teil I, Abteilung IV: Die christliche Religion. Mit Einschluß der israelitisch-jüdischen Religion. – Leipzig, Berlin: B. G. Teubner 1906, S. 722 f.
42
weiter zu. Ungeachtet der Ermahnung Kaiser Wilhelms II. „Völker Europas, wahret eure heiligsten Güter“, Dazu gehörte auch die Stimmung, wie sie in den ersten Zeilen des 1913 erschienenen Gedichtzyklus’ „Alaska“ von Gottfried Benn zum Ausdruck kommt, wo es heißt; „Europa, dieser Nasenpopel/ aus einer Konfirmandennase,/ wir wollen nach Alaska gehn.“ Siehe Benn, Gottfried, Gedichte (Gesammelte Werke in vier Bänden, hg. von Dieter Wellershoff, 3. Band.) – Wiesbaden: Limes 1960, S. 20.
43
stellte während des Weltkriegs Paul Natorp fest: „So wendet heute der sterbende Mensch des [10]Abendlandes seinen Blick zurück auf den Punkt des Aufgangs der geistigen Sonne, die wahre Geburtsstätte der Menschheit und all ihrer tiefen Träume von Gott und Seele: das Morgenland.“ Dies schrieb Kaiser Wilhelm II. im Jahre 1895 eigenhändig als Thema unter den Entwurf für ein Gemälde, das dann von Hermann Knackfuß ausgeführt wurde. Vgl. Glaser, Hermann, Die Kultur der Wilhelminischen Zeit. Topographie einer Epoche. – Frankfurt am Main: S. Fischer 1984, S. 15.
44
[10] Natorp, Paul, Deutscher Weltberuf. Geschichtsphilosophische Richtlinien, Erstes Buch: Die Weltalter des Geistes.-Jena: Diederichs 1918, S. 27. – Ähnlich formulierte dies Paul Natorp auch an anderer Stelle; siehe ders., Deutscher Weltberuf. Geschichtsphilosophische Richtlinien, Zweites Buch: Die Seele des Deutschen. – Jena: Diederichs 1918, S. 38: „Im Osten tagte zuerst das Licht – der Menschheit. Gott wurde da geboren und die Seele; in ihrem Wechselverhältnis: Der Mensch. […] Weit aufgeschlossen denken wir ihn uns, aufnehmend ohne Schranken, hingegeben, überwältigt. Jubel und Schmerz der rückhaltlosen Hingabe an das All, das unendliche, strömt überschwenglich sich aus in den Mythen der Veden, in den wortreich immer sich selbst übersteigernden Epen Alt-Indiens. Zuletzt aber, am nachhaltigsten, verbleibt vor allem – die dunkle Gegenseite, der völlige Verzicht der Selbstaufgabe, das Versinken in das Nirwâna. Das ist es, was in mannigfacher Abwandlung über ganz Ostasien verbreitet, die beherrschende Form der Weltanschauung des Morgenlandes wurde und es in jahrtausendelangem Schlummer gebannt hielt. Erkennt darin die Seele des Deutschen sich wieder? Erkennt sie da ihren Gott? Ich glaube nicht. Wie der Mensch des Westens überhaupt, ohne gegen solche Urweltstimmung unempfänglich zu sein, sich doch niemals darin gefangen geben wird.“
Allerdings hegte Natorp eigene, nationale Hoffnungen, wenn er meinte, durch die Zurückführung auf das „jetzt erst recht aktuell gewordene Problem von Okzident und Orient“ werde er „die gehörige Weite des Umblicks gewinnen“, um „die letzte, schicksalsschwere Frage erheben zu dürfen: wohinaus es denn mit dieser ganzen modernen Kultur des Abendlandes eigentlich will; […] und – die wichtigste Frage für uns – welche besondere Aufgabe dabei eben uns, der Seele des Deutschen, vorbehalten ist.“
45
Natorp, Paul, Deutscher Weltberuf. Geschichtsphilosophische Richtlinien, Zweites Buch: Die Seele des Deutschen. – Jena: Diederichs 1918, S. 5 f.
Der Weltkrieg als der Krieg der Europäer wurde in vielen außereuropäischen Ländern, ganz besonders in China, als Zeichen des moralischen Verfalls betrachtet, womit freilich nur bestätigt wurde, was manche schon vorher über die moralische und kulturelle Eigenart des Europäers gedacht hatten. Die Unterlegenheit des Europäers hatte etwa Ku Hung-ming (1857–1928) in einem im Jahre 1911 in deutscher Übersetzung erschienenen Aufsatz folgendermaßen zum Ausdruck gebracht: „Fast will es mir scheinen, als ob der Geisteszustand des modernen Durchschnitts-Europäers, der nach China kommt und von Fortschritt und Reform redet, noch weit hoffnungsloser wäre, als selbst der unserer alten chinesischen Literaten. Es ist wahr, die chinesischen Literaten kennen keine andere Kultur außer ihrer eigenen, aber sie wissen wenigstens etwas von ihrer eigenen Kultur. Der Durchschnitts-Engländer oder -Europäer auf der anderen Seite, der so gewandt von Fortschritt und Reform in China zu reden versteht, kennt nicht einmal seine eigene Kultur, ja er weiß nicht und kann nicht wissen, was [11]Kultur überhaupt ist […].“
46
– Im Gegensatz zu solchen Werturteilen über die eigene oder eine fremde Kultur enthielt sich Max Weber, ähnlich wie die Vertreter der Religionsgeschichtlichen Schule,[11] Ku Hung-ming. Chinas Verteidigung gegen europäische Ideen. Kritische Aufsätze, hg. von Alfons Paquet. – Jena: Diederichs 1911, S. 25.
47
bewußt solcher Wertungen. Friedrich Michael Schiele hatte in dem die ersten sieben Hefte seiner „Religionsgeschichtlichen Volksbücher“ vereinigenden Sammelband als die ersten zwei von fünf Grundgesetzen benannt: „1. Das Gesetz der moralischen Voraussetzungslosigkeit aller Wissenschaft. 2. Das Gesetz der Unverbrüchlichkeit der wissenschaftlichen Methode, die alle Weltgebiete nach ihrer Besonderheit ordnet, unter den gemeinsamen Regeln der Vernunft.“ Zitiert nach RGG1, Band 5, 1913, Sp. 1723.
Bereits in der spätestens im Jahre 1913 konzipierten und sicherlich erstmals auch niedergeschriebenen, im Jahre 1915 dann erschienenen „Einleitung“ sprach Weber deutlich aus, was ihn bei der Untersuchung der „Wirtschaftsethik“ interessierte, nämlich:
„die in den psychologischen und pragmatischen Zusammenhängen der Religionen gegründeten praktischen Antriebe zum Handeln.“
48
Siehe unten, S. 85.
Damit führte er methodisch weiter, was er in seinen Arbeiten zur Beziehung zwischen Protestantismus und Geist des Kapitalismus begonnen hatte.
In der im Jahre 1919 verfaßten „Vorbemerkung“ zu den „Gesammelten Aufsätzen zur Religionssoziologie“ hat Weber dann noch deutlicher zum Ausdruck gebracht, worum es ihm im Unterschied zu den Protestantismus-Studien in den Studien zur „Wirtschaftsethik der Weltreligionen“ ging. In jenen sei es ihm darum gegangen,
„in einem wichtigen Einzelpunkt der meist am schwierigsten zu fassenden Seite des Problems näher zu kommen: der Bedingtheit der Entstehung einer ‚Wirtschaftsgesinnung‘: des ,Ethos‘, einer Wirtschaftsform, durch bestimmte religiöse Glaubensinhalte, und zwar an dem Beispiel der Zusammenhänge des modernen Wirtschaftsethos mit der rationalen Ethik des asketischen Protestantismus.“
49
Weber, Vorbemerkung, S. 12.
Während er also dort „nur der einen Seite der Kausalbeziehung nachgegangen“ sei, beschreibt er seine Absicht bei den Aufsätzen zur „Wirtschaftsethik der Weltreligionen“ dagegen folgendermaßen:
„Die späteren Aufsätze über die ‚Wirtschaftsethik der Weltreligionen‘ versuchen, in einem Überblick über die Beziehungen der wichtigsten Kulturreligionen zur Wirtschaft und sozialen Schichtung ihrer Umwelt, beiden [12]Kausalbeziehungen soweit nachzugehen, als notwendig ist, um die Vergleichspunkte mit der weiterhin zu analysierenden okzidentalen Entwicklung zu finden. Denn nur so läßt sich ja die einigermaßen kausale Zurechnung derjenigen Elemente der okzidentalen religiösen Wirtschaftsethik, welche ihr im Gegensatz zu andern eigentümlich sind, überhaupt in Angriff nehmen.“
50
[12] Weber, Vorbemerkung, S. 12 f.
Und um möglichen falschen Erwartungen an seine Arbeiten von vornherein zu begegnen, schreibt er im Anschluß daran:
„Die Aufsätze wollen also nicht etwa als – sei es auch noch so gedrängte – umfassende Kulturanalysen gelten. Sondern sie betonen in jedem Kulturgebiet ganz geflissentlich das, was im Gegensatz stand und steht zur okzidentalen Kulturentwicklung. Sie sind also durchaus orientiert an dem, was unter diesem Gesichtspunkt bei Gelegenheit der Darstellung der okzidentalen Entwicklung wichtig erscheint.“
51
Weber, Vorbemerkung, S. 13.
2. Die Anfänge von Max Webers Beschäftigung mit außereuropäischen Religionen
Auch wenn, wie Wolfgang Schluchter festgestellt hat, 1909 Webers späteres „religionssoziologisches Programm noch nicht zu erkennen“ war
52
und er in den Jahren 1908/09 „hauptsächlich an den ,Agrarverhältnissen im Altertum‘ und an der ‚Psychophysik der industriellen Arbeit‘“ arbeitete, Schluchter, Rekonstruktion, S. 530.
53
hatte Weber doch bereits lange vorher weit über den Bereich Europas hinaus geblickt. So beginnt er den ersten Abschnitt „Vorbemerkungen“ seines im Jahre 1898, also nur ein Jahr nach der ersten Auflage in wesentlich überarbeiteter Form erschienenen Beitrages „Agrarverhältnisse des Altertums“ mit den Worten: Weber, Agrarverhältnisse im Altertum3; die Arbeit „Zur Psychophysik der industriellen Arbeit“ erschien in Fortsetzungen im Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik in den Bänden 27 bis 29 in den Jahren 1908 und 1909 (MWG I/11); siehe auch Schluchter, Rekonstruktion, S. 531.
„Den Siedlungen des Occidents ist im Gegensatz zu denjenigen der ostasiatischen Kulturvölker gemeinsam […].“
54
Weber, Agrarverhältnisse im Altertum2, S. 57. In der ersten Auflage von 1897 spricht Weber nicht von „ostasiatischen“, sondern von „asiatischen Kulturvölkern“. Siehe Weber, Agrarverhältnisse im Altertum1, S. 1. In der 3. Auflage von 1909 ist der Abschnitt „Zur ökonomischen Theorie der antiken Staatenwelt“ überschrieben, und der Text lautet: „Den Siedlungen des europäischen Occidents ist im Gegensatz zu denjenigen der ostasiatischen Kulturvölker gemeinsam […]“ ; vgl. Weber, Agrarverhältnisse im Altertum3, S. 52; [13]wiederabgedruckt in: Weber, Max, Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1924, S. 1 (MWG I/6).
[13]Sodann stellt er die Vieh-, insbesondere die Milchviehzucht im europäischen Okzident dem gartenmäßigen Ackerbau ohne Milchviehhaltung der ostasiatischen Kulturvölker gegenüber. Und auch die von ihm behandelten „Hauptgebiete der alten Kultur“ umfassen in der zweiten Auflage seines Handwörterbuchartikels über die „Agrarverhältnisse im Altertum“ bereits mehr als den Okzident im engeren Sinne, nämlich Mesopotamien, Ägypten und Altisrael und dann erst Griechenland, den Hellenismus, Rom und die römische Kaiserzeit. Der Blick nach Asien kommt zwar in der ersten Auflage schon deutlich zur Geltung, doch wird er erst in der zweiten Auflage durch Hinzufügung eines eigenen Kapitels über den Orient, den Weber in zwei Abschnitte über Ägypten und den asiatischen Orient unterteilt, differenzierend ausgeweitet. Hier bereits, also im Jahre 1898, zeigte sich, daß Weber die Eigenart des europäischen Okzidents durch Gegenüberstellung mit anderen, vornehmlich den asiatischen, Kulturvölkern tiefer zu verstehen trachtete. In den „Agrarverhältnissen“ spricht er davon, daß bei „den Asiaten“ die „Erscheinungen primitiver Flurgemeinschaft, z. B. der occidentale Begriff von Mark und Allmende, fehlen.“
55
Und er fährt fort: Weber, Agrarverhältnisse im Altertum1, S. 1; Agrarverhältnisse im Altertum2, S. 58; in der 3. Auflage, S. 52, wird dieser Satz ergänzt durch den Halbsatz „oder doch einen anderen ökonomischen Sinn haben“.
„Die Flurgemeinschaftselemente in den orientalischen Dorfverfassungen zeigen daher, soweit sie nicht überhaupt modernen Ursprungs, z. B. aus der Steuerverfassung hervorgegangen sind, ein von den europäischen ganz abweichendes Gepräge. – Und der gleiche Gegensatz trägt noch weiter. Auch der Individualismus des Herdenbesitzes mit seiner scharfen ökonomischen und sozialen Differenzierung, – im Occident der primitive Ausgangspunkt des Feudalismus – fehlt den asiatischen Kulturvölkern.“
56
Weber, Agrarverhältnisse im Altertum2, S. 58. Diese Passage wurde nur unwesentlich gegenüber der ersten Auflage verändert. – In der 3. Auflage von 1909 veränderte Weber den letzten Satz zu: „Und auch der ‚Individualismus‘ des Herdenbesitzes mit seinen Folgen fehlt den ostasiatischen Völkern.“
Ostasien, insbesondere China, diente Weber in jener Zeit jedoch zu nicht mehr als einem Gegenbild, wie dies etwa in seiner im Jahre 1896 gedruckten Freiburger Rede über „Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur“
57
bereits zu Beginn zum Ausdruck kommt. Hier heißt es: Erschienen in: Die Wahrheit. Halbmonatsschr. zur Vertiefung in die Fragen und Aufgaben des Menschenlebens, 6. Band, 1. Maiheft 1896, S. 57–77 (MWG I/6).
„Für unsere heutigen sozialen Probleme haben wir aus der Geschichte des Altertums wenig oder nichts zu lernen. Ein heutiger Proletarier und ein antiker Sklave verständen sich so wenig wie ein Europäer und ein Chinese.“
[14]Doch als ein eigener Forschungsgegenstand war für Weber zu jener Zeit Ostasien offenbar noch nicht in das Blickfeld gerückt. Dies geschah erst mehr als ein Jahrzehnt später.
Inzwischen hatte ja auch die Sinologie begonnen, sich als akademisches Fach durchzusetzen, und Nachrichten aus China und über China erreichten Europa in zunehmendem Maße, was nicht zuletzt eine Folge des wirtschaftlichen Engagements und der kolonialen Interessen der europäischen Mächte war. Dieses verstärkte Interesse an China kommt auch in der Rede Otto Frankes auf der Plenarsitzung des Deutschen Kolonialkongresses im Jahre 1905 am Nachmittag des 7. Oktober über „Die politische Idee in der ostasiatischen Kulturwelt“ zum Ausdruck.
58
In dieser Rede, die mit einer Resolution schloß, in der „ein tieferes Eindringen in die ostasiatische Kulturwelt und ein gründlicheres Verständnis ihres Wesens“ sowie „die Errichtung von ordentlichen Professuren für wissenschaftliche Sinologie an deutschen Universitäten“ gefordert wurde,[14] Abgedruckt in den Verhandlungen des Deutschen Kolonialkongresses 1905. – Berlin: Dietrich Reimer (Ernst Vohsen) 1906, S. 161–169. – Am Vormittag desselben Tages war übrigens die zu Beginn eines Sektionsvortrages über „Die wirtschaftliche Bedeutung des Yangtse-Gebiets“ von Georg Wegener gemachte Mitteilung von dem Tode Ferdinand von Richthofens, des Geographen und Chinareisenden, mit „großer Bewegung“ von den Zuhörern aufgenommen worden. Siehe ebd., S. 989; über Ferdinand von Richthofen und seine Erforschung Chinas zusammenfassend Osterhammel, Jürgen, Forschungsreise und Kolonialprogramm. Ferdinand von Richthofen und die Erschließung Chinas im 19. Jahrhundert, in: Archiv für Kulturgesch., 69. Band, Heft 1, 1987, S. 150–195.
59
hatte Otto Franke betont: „Die verschiedenen fremden Religions-Systeme, die auf die ostasiatische Kulturwelt eingewirkt haben und heute noch einwirken, sind denn auch bisher nicht imstande gewesen, die Macht der confuzianischen Ideen gerade über die aufgeklärtesten Geister zu brechen.“ Verhandlungen des Deutschen Kolonialkongresses 1905, S. 168 f.
60
Und er hatte darauf hingewiesen, daß „der Geist des Abendlandes“ „Ostasien so wenig wie die Welt des Islam bisher von seiner unbedingten Superiorität“ habe überzeugen können. Ebd., S. 162 f.
61
Mit solchen und anderen Argumenten war die Aufnahme der Sinologie in die akademische Welt betrieben worden, und 1909 wurde schließlich Otto Franke als Professor an das Hamburger Kolonialinstitut berufen, das später mit den anderen hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten in der Universität Hamburg aufging; erst 1912 wurde in Berlin eine sinologische Professur eingerichtet, die dann mit dem Holländer J. J. Μ. de Groot besetzt wurde. Ebd., S. 167.
62
Die große Zahl der Publikationen über China seit dem Ausgang [15]des 19. Jahrhunderts und in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts, Zur Geschichte der Sinologie in Deutschland siehe den Überblick von Herbert Franke, Sinologie an deutschen Universitäten. Mit einem Anhang über Mandschustudien. – Wiesbaden: Steiner 1968. Vgl. auch Hänisch, Erich, Die Sinologie an der Berliner Friedrich-[15]Wilhelms-Universität in den Jahren 1889–1945, in: Studium Berolinense. – Berlin: de Gruyter 1960. – Zeitgenössische Berichte finden sich von W. Knappe unter dem Titel „Chinaforschung“ in mehreren Fortsetzungen in: Asien. Organ der Deutsch-Asiatischen Gesellschaft, 7. Jg. – Berlin: Hermann Pätel 1908; Jacobi, E., Die sinologischen Studien in Deutschland, in: Zeitschr. für Kolonialpolitik. Kolonialrecht und Kolonialwirtschaft, Jg. 12, Heft 9, September 1910, S. 681–684; Franke, Otto, Die sinologischen Studien in Deutschland, in: ders., Ostasiatische Neubildungen. – Hamburg: C. Boysen 1911, S. 357–377.
63
vor allem aber auch die zum Teil schon länger bestehenden, zumeist aber noch recht jungen führenden asienwissenschaftlichen und sinologischen Zeitschriften wie Journal Asiatique, Eine Zusammenstellung der abendländischen Literatur über China findet sich in: Cordier, Henri, Bibliotheca Sinica. Dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à l’empire Chinois, Vol. 1–4, 2. Aufl. – Paris: Guilmoto 1904–1908; Vol. 5. – Paris: Geuthner 1924.
64
T’oung Pao, Seit 1822.
65
Bulletin de l’École Française d’Extrême Orient, Seit 1890.
66
Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen Seit 1900.
67
sowie die Übersetzungen wichtiger Texte durch James Legge, Édouard Chavannes, Richard Wilhelm und andere und schließlich, aber nicht zuletzt die bereits erwähnte Berücksichtigung Chinas in Fachzeitschriften und Handbüchern trugen mit dazu bei, daß fundiertere religionssoziologische Überlegungen über China überhaupt erst in Angriff genommen werden konnten. Seit 1898.
In nähere Berührung mit außereuropäischen Religionen war Weber einmal durch seine Beziehung zu Angehörigen der von ihm selbst wiederum nicht unerheblich beeinflußten religionsgeschichtlichen Schule sowie dann durch den Heidelberger Eranos-Kreis gekommen, in dem unter anderem auch die alte chinesische Religion thematisiert worden war. Einen Hinweis darauf, daß Weber in weitreichenderem Maße aber erst nach 1909/10 sein Blickfeld erweiterte und sich selbst eingehender mit dem Orient und anderen Weltreligionen beschäftigte, gibt Marianne Weber im „Lebensbild“. Sie berichtet hier, daß es Weber, als „er dann (etwa um 1911) die religionssoziologischen Studien wieder aufnimmt, […] in den Orient: nach China, Japan und Indien, dann zum Judentum und dem Islam“
68
gezogen habe. Weber, Marianne, Max Weber. Ein Lebensbild, 3. Aufl. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1984, S. 346; hinfort zitiert als Weber, Marianne, Lebensbild3.
Einen Niederschlag fand dieses neue Interesse Webers bereits in dem 1913 erschienenen Aufsatz „Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie“,
69
in dem sich, wie Wolfgang Schluchter festgestellt hat, in den Ab[16]schnitten I bis III, „besonders unter II, Bezüge auf Resultate vergleichender religionssoziologischer Forschungen“ Erschienen in: Logos. Internationale Zeitschr. für Philosophie der Kultur, 4. Band, 3. Heft, 1913, S. 253–294 (MWG I/12).
70
finden. Damit ist unzweifelhaft, daß Weber im Jahre 1913 mit seinen religionssoziologischen Überlegungen nicht mehr in den Anfängen steckte. [16] Schluchter, Rekonstruktion, S. 531 f.
Zwischen Max Webers Arbeiten zum Protestantismus der Jahre 1904 bis 1906 und seinen Studien zur „Wirtschaftsethik der Weltreligionen“ hatte offenbar eine „Entdeckung“ gelegen.
71
Insofern sind diese Studien nicht nur eine Fortsetzung und Entfaltung, sondern, wie Wolfgang Schluchter betont, eine Erweiterung von Thematik und Fragestellung. Von einer solchen „Entdeckung“ Webers, die sie in die Zeit zwischen 1909 und 1913 datiert, schreibt Marianne Weber: Schluchter, Rekonstruktion, S. 528.
„Für Weber bedeutete diese Erkenntnis der Besonderheit des okzidentalen Rationalismus und der ihm zugefallenen Rolle für die abendländische Kultur eine seiner wichtigsten Entdeckungen. Infolge davon erweitert sich seine ursprüngliche Fragestellung nach dem Verhältnis von Religion und Wirtschaft nun zu der noch umfassenderen, nach der Eigenart der ganzen abendländischen Kultur.“
72
Weber, Marianne, Lebensbild3, S. 349.
Diese Entdeckung prägte fortan Webers Denken in vielfältiger Hinsicht. Und daraus erklärt sich auch die später von ihm selbst betonte enge Beziehung zwischen seinen Arbeiten für „Wirtschaft und Gesellschaft“ und seinen vergleichenden religionssoziologischen Studien. Die Notwendigkeit des interkulturellen Vergleichs aber beschränkte sich für Weber nicht auf die Religion und ihre Funktionen, sondern bezog sich auf alle gesellschaftswissenschaftliche Forschung. So betonte er etwa in einem Brief an Georg von Below vom 21. Juni 1914:
„Ich werde wohl im Winter anfangen, einen ziemlich umfangreichen Beitrag zum ,Grundriß der Sozialwissenschaften‘ drucken zu lassen, der die Form der politischen Verbände vergleichend und systematisch behandelt“.
Und es heißt im selben Brief weiter:
„das, was der mittelalterlichen Stadt spezifisch ist, […] ist doch nur durch die Feststellung: was andern Städten (antiken, chinesischen, islamischen) fehlte, zu entwickeln“.
73
Zitiert nach Below, Georg von, Der deutsche Staat des Mittelalters, 2. Aufl., 1. Band: Die allgemeinen Fragen. – Leipzig: Quelle und Meyer 1925, S. XXIV f. – Das Original ist verschollen. Es existiert noch eine Abschrift von der Hand Marianne Webers in: ZStA Merseburg, Rep. 92, Nl. Max Weber, Nr. 30, Bd. 11, Bl. 78–79.
Der Klärung dieser erweiterten Thematik und der damit verbundenen Fragestellungen dienen die Arbeiten Webers zu seinem systematischen Werk „Wirtschaft und Gesellschaft“ ebenso wie die Studien zur „Wirt[17]schaftsethik der Weltreligionen“ und sicherlich auch jene zur Soziologie der Musik je auf ihre Weise. Eine Mitteilung Marianne Webers weist darauf hin, daß Weber „etwa 1910“ eine Untersuchung der Musik auf ihre rationalen und soziologischen Grundlagen unternahm
74
und daß es sich bei dieser Studie um die erste handelt, in der Weber seiner erweiterten Fragestellung nach „der Eigenart der ganzen abendländischen Kultur“[17] Weber, Marianne, Lebensbild3, S. 349.
75
nachging. Im Jahre 1911 „bedenkt“ er, nach Marianne Webers Mitteilung, „seine musik-soziologische Abhandlung“. Ebd.
76
Weber, Marianne, Lebensbild3, S. 507.
Ein Blick auf die Werkpläne verdeutlicht den Zusammenhang der beiden Werkgruppen von „Wirtschaft und Gesellschaft“ einerseits und „Wirtschaftsethik der Weltreligionen“ andererseits, auf den Weber ja selbst hinweist, wenn er schreibt, daß diese Aufsätze
„nebenbei auch bestimmt [waren], gleichzeitig mit der im ‚Grundriß der Sozialökonomik‘ enthaltenen Abhandlung über ‚Wirtschaft und Gesellschaft‘ zu erscheinen, den religionssoziologischen Abschnitt zu interpretieren und zu ergänzen (allerdings auch in vielen Punkten durch ihn interpretiert zu werden).“
77
Siehe unten, S. 83 f., Webers Anm. 1; vgl. Schluchter, Rekonstruktion, S. 529.
Man muß davon ausgehen, daß von Webers religionssoziologischen Studien, die seit dem September 1915 im „Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik“ als „Religionssoziologische Skizzen“ erschienen, zumindest diejenige zum Konfuzianismus tatsächlich, wie er selbst in der ersten Fußnote schreibt, „so wie sie vor zwei Jahren niedergeschrieben und Freunden vorgelesen“ war, abgedruckt wurde.
78
Im Zusammenhang des Projektes „Wirtschaft und Gesellschaft“ für den „Grundriß der Sozialökonomik“ entstanden, haben seine Überlegungen zur Religionssoziologie ihrerseits die Konzeption dieses Projektes verändert, wie sich an der gegenüber dem Stoffverteilungsplan von 1909 veränderten Gliederung von 1914 ablesen läßt. Zum Verhältnis der früheren und der späteren Fassung der Studie zum Konfuzianismus bzw. Konfuzianismus und Taoismus siehe ausführlicher im Editorischen Bericht, unten, S. 52 f. und 64 f.
79
Vgl. Schluchter, Rekonstruktion, S. 557; siehe auch unten, S. 32.
3. Max Webers Quellen
Einen beträchtlichen Teil der von Weber benutzten Literatur machen die von Missionaren verfaßten Werke aus. Manche dieser Bücher gehören zu den [18]zu jener Zeit in der westlichen Welt am meisten gelesenen Bücher über China, wie Arthur H. Smith, Chinese Characteristics.
80
Andere Werke sind inzwischen selbst für Sinologen zu „Quellen“ geworden, da sie längst vergangene Zustände dokumentieren, wie etwa Wilhelm Grubes Werk zur Pekinger Volkskunde.[18] Siehe Hayford, Charles W., Chinese and American Characteristics: Arthur H. Smith and His China Book, in: Barnett, Suzanne Wilson, und Fairbank, John King (Hg.), Christianity in China. Early Protestant Missionary Writings. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1985, S. 153–174.
81
Siehe Grube, Pekinger Volkskunde (vgl. das Verzeichnis der von Max Weber zitierten Literatur, unten, S. 557 ff.)
Die von Weber zu Rate gezogene Literatur ist, wenn auch mit oft ungenauen bibliographischen Angaben, von Weber selbst weitgehend aufgeführt worden. Freilich verwendet er Sprache und gängige Begriffe seiner Zeit, deren Herkunft, wenn sie ihm überhaupt selbst bewußt war, in der vorliegenden Edition nachzuweisen als abwegig hätte erscheinen müssen. Für eine spätere Beschäftigung mit dem Werk Max Webers ist jedoch eine Zeichnung des intellektuellen Hintergrundes und ein Nachweis der von ihm mehr oder weniger bewußt angetretenen geistigen Erbschaften äußerst wünschenswert. Auch wenn in der vorliegenden Ausgabe in den Anmerkungen des Herausgebers eine große Zahl der Quellen Max Webers namhaft gemacht werden, so war es doch nicht die Aufgabe des Editors, Webers Ausführungen auf den Wissensstand seiner Zeit zu beziehen und lückenlos zu ermitteln, wo er sich der Gedanken und Begriffe anderer bediente und wo er eigene Wege ging, vielmehr war es das Ziel, für Überlegungen in diese Richtung eine bessere Grundlage zu schaffen.
82
Erste Überlegungen hierzu hat Küenzlen, Gottfried, Unbekannte Quellen der Religionssoziologie Max Webers, in: Zeitschr. für Soziologie, Jg. 7, 1978, S. 215–227, angestellt; wiederholt in: ders., Die Religionssoziologie Max Webers. Eine Darstellung ihrer Entwicklung. – Berlin: Duncker & Humblot 1980, S. 58–76.
Bei der Behandlung vieler Fragen folgt Weber ganz deutlich weit verbreiteten Vorstellungen. So verweist er etwa, wie vor ihm Karl Marx und englische Nationalökonomen, wiederholt auf die Bedeutung der Wasserregulierung für die politische und gesellschaftliche Entwicklung Chinas.
83
Bei allem [19]aber verkannte Weber nicht den durchaus provisorischen Charakter seiner Arbeiten, wenn er im Jahre 1919 in der „Vorbemerkung“ schreibt: So auf den Seiten 154, 159, 165, 175, 185 f., 210 f., 244, 288. – Auf die „Geographischen Grundlagen der Weltgeschichte“ und die Bedeutung der Talebenen für die Stiftung großer Staaten hatte schon G. W. F. Hegel in seinen „Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte“ hingewiesen. – Karl August Wittfogel, der sich in den 20er Jahren mit Max Webers Studie über Konfuzianismus und Taoismus beschäftigt hatte (siehe unten, S. 25), bezieht sich in seinem zuerst im Jahre 1957 in Amerika in englischer Sprache unter dem Titel „Oriental Despotism“ erschienenen Werk, in dem er eine Theorie der „hydraulischen Gesellschaften“ entwirft, auf Weber als einen seiner Vorläufer. Vgl. Wittfogel, Karl A., Die Orientalische Despotie. Eine vergleichende Untersuchung totaler Macht. – Köln, Berlin: Kiepenheuer & Witsch 1962, S. 28. – Vgl. hierzu auch Zingerle, [19]Arnold, Max Weber und China. Herrschafts- und religionssoziologische Grundlagen zum Wandel der chinesischen Gesellschaft. – Berlin: Duncker & Humblot 1972, S. 59–64.
„Der Sinologe, Indologe, Semitist, Ägyptologe wird in ihnen natürlich nichts ihm sachlich Neues finden. Wünschenswert wäre nur: daß er nichts zur Sache Wesentliches findet, was er als sachlich falsch beurteilen muß. […] Es ist ganz klar, daß jemand, der auf die Benützung von Übersetzungen und im übrigen darauf angewiesen ist, über die Art der Benutzung und Bewertung der monumentalen, dokumentarischen oder literarischen Quellen sich in der häufig sehr kontroversen Fachliteratur zu orientieren, die er seinerseits in ihrem Wert nicht selbständig beurteilen kann, allen Grund hat, über den Wert seiner Leistung sehr bescheiden zu denken. Um so mehr, als das Maß der vorliegenden Übersetzungen wirklicher ‚Quellen‘ (d. h. von Inschriften und Urkunden) teilweise (besonders für China) noch sehr klein ist im Verhältnis zu dem, was vorhanden und wichtig ist. Aus alledem folgt der vollkommene provisorische Charakter dieser Aufsätze, insbesondere der auf Asien sich beziehenden Teile. […] Sie sind in einem ungleich stärkeren Maß und Sinn dazu bestimmt, bald ‚überholt‘ zu werden, als dies letztlich von aller wissenschaftlichen Arbeit gilt.“
84
Weber, Vorbemerkung, S. 13 f.
4. Zur Rezeption des Werkes in der zeitgenössischen Kritik
Erste Stimmen zu Webers Aufsätzen zur „Wirtschaftsethik der Weltreligionen“ finden sich in den Nachrufen. So schreibt etwa Josef Schumpeter in seinem am 7. August 1920 erschienenen Nachruf mit dem Titel „Max Webers Werk“:
„Das materielle Komplement zu diesen Leistungen sind dann seine Arbeiten: ,Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus‘ und ,Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen‘. […] Sie sind nicht nur die besten soziologischen Leistungen Deutschlands, sondern auch das Zentrum einer deutschen Soziologenschule und haben unendlich fruchtbar gewirkt.“
85
In: Der österreichische Volkswirt, 12. Jg., 31. Juli 1920; zitiert nach König, René, und Winckelmann, Johannes (Hg.), Max Weber zum Gedächtnis (Kölner Zeitschr. für Soziologie und Sozialpsychologie. Sonderh. 7). – Köln und Opladen: Westdeutscher Verlag 1963 [2. Aufl. 1985], S. 68.
Emil Lederer, damals Redaktionssekretär des „Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik“, veröffentlichte einen Nachruf,
86
in dem er über die „Wirtschaftsethik der Weltreligionen“ schreibt: Erschienen im Archiv für Sozialwiss. und Sozialpolitik, 48. Band, 1920/21, Heft 1, S. I–IV.
[20]„Was aber insbesondere seine letzten großen Beiträge über die Wirtschaftsethik der Weltreligionen anlangt (vor vielen Jahren auf das Fruchtbarste durch die grundlegende Abhandlung über „Die protestantische Ethik und den Geist des Kapitalismus“ eingeleitet), so bedeuten sie eine völlig neue Epoche, zumal für die soziologische Forschung. Es mag heute noch strittig sein, ob und welche Gesamtanschauung für die Menschheitsgeschichte aus diesem monumentalen Werke erwachsen wird – hier ist die ganze ungeheure Welt der transzendentalen Bildungen bewältigt, und der sozialen Einsicht erobert. Und damit ist diese selbst, ist Sozialwissenschaft im weitesten Sinne in die Universalgeschichte des menschlichen Geistes eingegliedert.
Und wenn diesem Werk auch nicht die Absicht zugrunde lag, den immanent religiösen Sinn der Weltreligionen zu erschließen, so strömt doch aus dieser mächtigen Arbeit, welche die Funktionalbeziehungen zwischen religiös geforderten Lebensmaximen und menschlicher Sozietät enthüllt, ein unverhofftes Licht auf die tiefsten Geheimnisse noch unerschlossener und wieder versunkener Wahrheiten.“
87
[20] Ebd., S. lll.
In den Nachrufen kam auch schon die Frage auf, ob „Wirtschaft und Gesellschaft“ oder aber die „Gesammelten Aufsätze zur Religionssoziologie“ die wichtigere Hinterlassenschaft Max Webers seien. Ernst Correll bezeichnet in seinem Nachruf auf Max Weber die religionssoziologischen Untersuchungen als „die Hauptarbeit seiner letzten Jahre“.
88
Hermann Kantorowicz nennt in seinem Nachruf die Abhandlungen zur Religionssoziologie „epochemachend“, „Wirtschaft und Gesellschaft“ aber „das Hauptwerk“. Erschienen in: Die Hochschule, 4. Jahrgang, 1920, 4. Heft; abgedruckt in: König und Winckelmann, Max Weber zum Gedächtnis (wie Anm. 85), S. 90–94, hier S. 92.
89
Erschienen in der Zeitschrift Logos, Band 11, 1922; abgedruckt in: König und Winckelmann, Max Weber zum Gedächtnis (wie Anm. 85), S. 94–98, hier S. 94.
In den zahlreichen Rezensionen zu den in den Jahren 1920 und 1921 erschienenen drei Bänden der „Gesammelten Aufsätze zur Religionssoziologie“ wird die Studie zu „Konfuzianismus und Taoismus“ nur am Rande gewürdigt. Dies hat zum Teil seinen Grund auch darin, daß, wie Leopold Zscharnack in seiner Besprechung der drei Bände unter Hinweis auf die „Vorbemerkung“
90
ausführte, „alles Orientalische Weber ja nur als Vergleichsobjekt und als Gegensatz zur okzidentalen Kulturentwicklung interessierte und nur in dieser Begrenzung zur Darstellung gelangen sollte“. Weber, Vorbemerkung, S. 12 f.
91
Doch auch von sinologischer Seite wurde die Arbeit Webers nur wenig zur Kenntnis genommen. Dies mag mit einem Umstand zusammenhängen, [21]den Georg von Below in seiner Besprechung des ersten Bandes der „Gesammelten Aufsätze zur Religionssoziologie“ folgendermaßen kennzeichnet: „Die Zahl der wirklichen Sachkenner wird um so kleiner sein, als die vorhandenen Sinologen keineswegs sämtlich mit den philosophischen, theologischen und nationalökonomischen Fragestellungen, über die W[eber] verfügt, vertraut sind.“ Zeitschr. für Kirchengesch., 40. Band, Neue Folge III, 1922, S. 226.
92
[21] Zeitschr. für Sozialwiss., Neue Folge, 12. Jahrgang, 1921, S. 213.
Rezensionen erschienen auch in der Tagespresse. In der Vossischen Zeitung vom 19. Dezember 1920 heißt es u.a.: „Am fruchtbarsten ist der große Aufsatz über die Wirtschaftsethik der Weltreligionen, weil er den Blick weitet nach jenem Osten, der die Wiege der Religionen war, dessen Rätsel zu lösen uns heute mehr denn je notwendig ist.“ In der Neuen Zürcher Zeitung, Nr. 2120 vom 22. Dezember 1920, 1. Mo.Bl., und Nr. 2128 vom 23. Dezember 1923, 2. Mo.Bl., bespricht Heinrich Sieveking „Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Konfuzianismus und Taoismus“. In der Spalte: „Bücherecke“ von „Die Furche“, dem „Unterhaltungsblatt zur Fränkischen Tagespost“, Neue Folge, 1. Jg., Nr. 128 vom 10. Dezember 1920, S. 512, heißt es über Band 1 der „Gesammelten Aufsätze zur Religionssoziologie“ u. a.: „Wir sehen, wie das religiöse Wollen von einst wirtschaftliches Müssen von jetzt geworden ist. Diese eminent wichtige Erkenntnis müssen wir uns freilich sauer erkämpfen. Manches Wenn und Aber, Für und Wider ballt sich zu gefährlich langen Anmerkungen unterm Strich zusammen und erschwert dem an wissenschaftliche Lektüre nicht Gewöhnten Verständnis und Genuß dieses Buches. Dieser Umstand, dann die überreich verwendeten Fremdwörter und endlich der sehr hohe Preis des Werkes lassen das Buch für den Arbeiter von vornherein ausscheiden. Akademisch gebildete Genossen dagegen sollten sich seine Lektüre zur lohnenden Pflicht machen.“
In der Zeitschrift „Hochland“, 18. Jg., Heft 6 vom März 1921, S. 746–748, schreibt Alois Dempf unter dem Titel „Religionssoziologie“ unter anderem, S. 747: „Ich wüßte keine Darstellung der chinesischen Religion vor allem, die so umfassend deren innere Ausgestaltung und Entfaltung in und aus dem Kulturganzen darstellt wie die Webers.“ In der „Zeitschrift für Sozialwissenschaft“, Neue Folge, 12. Jg., 1921, S. 211–213, macht Georg von Below, unter Hinweis auf eine im vorausgegangenen Jahrgang der selben Zeitschrift erschienene Besprechung einiger der von Weber zuletzt veröffentlichten Schriften durch den ebenfalls im Jahre 1920 verstorbenen Wilhelm Hasbach (eine Rezension von der „ Wichtigkeit eines geschichtlichen Dokuments“), Max Weber den Vorwurf, er habe sich bei seinem Eintritt für die Übernahme der Verfassung Englands, die „dort schon überwunden“ sei, „in der politischen Praxis zu dem ober[22]sten Grundsatz der historischen Schule, daß auf ein Volk nicht die unter ganz anderen Verhältnissen erwachsene Verfassung eines fremden Volkes übertragen werden könne, in Gegensatz gestellt“. Diese widerspruchsvolle Praxis sei um so bedeutungsvoller, als Weber wohl als „das wissenschaftliche Haupt der deutschen Demokratie angesehen werden“ dürfe. – Über den Teil zur „Wirtschaftsethik der Weltreligionen“ im ersten Band der „Gesammelten Aufsätze zur Religionssoziologie“ schreibt von Below dann, nach der Besprechung der ersten beiden Studien zur Protestantischen Ethik und zu den Protestantischen Sekten: „Die dritte, die umfangreichste, behandelt einen Stoff, für den sehr wenig Sachkenner zur Verfügung stehen. Nach einer allgemeinen Einleitung schildert sie den ,Konfuzianismus und Taoismus‘, welcher Schilderung dann noch eine kurze Zwischenbetrachtung angehängt ist: ‚Theorie der Stufen und Richtungen religiöser Weltablehnung‘.“ In Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche, Jg. 46, 1922, S. 251–258, beschäftigte sich Otto Hintze – ebenso wie die meisten anderen Rezensenten – nur sehr allgemein mit den „Gesammelten Aufsätzen zur Religionssoziologie“. Er nimmt fast ausschließlich auf die „Einleitung“ und die „Zwischenbetrachtung“ Bezug. Hintze greift Webers in der „Vorbemerkung“ geäußerte Ansicht auf, welche Rolle die Erbqualitäten für die Klärung der Frage nach den unterschiedlichen Entwicklungen von Orient und Okzident spielen könnten, die Weber in dem Satz gipfeln läßt: „Vorerst scheint mir jene Voraussetzung zu fehlen und wäre die Verweisung auf ,Erbgut‘ ein voreiliger Verzicht auf das heute vielleicht mögliche Maß der Erkenntnis und eine Verschiebung des Problems auf (derzeit noch) unbekannte Faktoren“ (Weber, Vorbemerkung, S. 16). Otto Hintze schreibt dazu: „Es ist zwar sehr richtig, daß der Rekurs auf den National- oder Rassencharakter oft nur ein Ausdruck für soziologische Ignoranz, auch wohl für bequeme Gedankenlosigkeit ist; es gilt eben, möglichst viel von dem historisch gewordenen Charakter der Rassen und Nationen genetisch zu erklären durch die geistigen und materiellen Kulturfaktoren, die anerkanntermaßen im Laufe der Geschichte den Menschenschlag beeinflussen und fortbilden. […] Aber wenn das Rassenproblem, wie es vielen modernen Soziologen beliebt, weiterhin beiseite geschoben wird, so würde das heutige ‚ignoramus‘ nur gleich mit dem ‚ignorabimus‘ verbunden werden können.“ (S. 257–58). Ebenfalls in Schmollers Jahrbuch, im 48. Jg., 1924, S. 1–30, setzt sich Ferdinand Tönnies in seinem Aufsatz „Kulturbedeutung der Religionen“ auf weiten Strecken, insbesondere S. 14–28, mit Webers erstem Band der „Gesammelten Aufsätze“ auseinander.
In der „Literarischen Beilage“ zur Augsburger Postzeitung, Nr. 8 vom 21. Februar 1922, geht Georg Wunderle am Schluß seiner Besprechung auf die Schilderung der konfuzianischen Lebensorientierung (vgl. unten, [23]S. 332 ff.) ein und schreibt: „Die folgende Schilderung der konfuzianischen Lebensorientierung ist allgemein kulturell ebenso interessant wie soziologisch; dazu dürfte vielleicht manche Ergänzung bieten das eben erschienene Büchlein von R. Eucken und Carsun Chang: ‚Das Lebensproblem in China und Europa‘ (Leipzig 1922, bei Quelle u. Meyer). Die abschließende Vergleichung und Gegenüberstellung von konfuzianischer Orthodoxie und taoistischer Heterodoxie zeigt die seltene Fähigkeit Webers zu wissenschaftlicher Synthese. Die auf eindringlichste Kenntnis der Religionsgeschichte gestützte soziologische Untersuchung wird in ihren Ergebnissen veranschaulicht durch die Rückbeziehung auf den Puritanismus. Ich möchte dabei an eine fesselnde Parallele erinnern: Nathan Söderblom hat in seinem Buch über ‚Das Werden des Gottesglaubens‘ (Leipzig 1916) die Idee des chinesischen Himmelsgottes, der ihm die charakteristischen Züge eines primitiven ‚Urheber‘-Gottes zu tragen schien, fast vorbildlich sein lassen für den europäischen, genauer gesagt, englischen Deismus, und nun bringt Max Weber die chinesische Art der Rationalisierung des Lebens in vergleichende Beziehung gerade mit dem englischen Puritanismus, dessen prädestinierender Gott dem menschlichen Leben wahrlich nicht müßig zuschaut.“
Friedrich Kreis besprach den ersten Band der Gesammelten Aufsätze in Logos. Internationale Zeitschrift für Philosophie und Kultur, Band 10, 1921/22, S. 244–247, und die Theologischen Literaturberichte, Jg. 1922, Nr. 4 und 5, enthalten eine Besprechung des ersten Bandes der „Gesammelten Aufsätze zur Religionssoziologie.“
93
Im Schwäbischen Merkur vom 9. Dezember 1922 heißt es in einer ‚Kurzen Notiz‘ zu Beginn: „Max Webers Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie (3 Bände, Mohr, Tübingen) bedürfen heute keiner Empfehlung mehr; sie sind längst denen, die sich mit den beiden im Titel angedeuteten Gebieten beschäftigen, unentbehrlich geworden.“ Und in den Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik, 118. Band (63. Band der III. Folge), 1922, S. 474–481, bespricht Paul Barth die drei Bände der „Gesammelten Aufsätze“. In der Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 16. Band, 1922, Heft 3/4, S. 420–434, bespricht E. Rothacker die 3 Bände der „Gesammelten Aufsätze zur Religionssoziologie“ sowie die ersten beiden Lieferungen von „Wirtschaft und Gesellschaft“. In der Theologischen Literaturzeitung, 1923, Nr. 24, Sp. 505–511, heißt es in der von Andreas Walther verfaßten Besprechung der drei Bände „Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie“, in Sp. 508: „Daß aber nun die Behandlung der orientalischen Religionen eine sinnge[24]mäße Fortsetzung dieser Studien[23] Gezeichnet: „Weber, Bonn“; wahrscheinlich handelt es sich um den Systematiker Hans Emil Weber (8.3.1882–13.6.1950).
94
wurde, wird aus der Erwägung verständlich, daß in der Tat keine noch so minutiöse Untersuchung der neuzeitlichen Entwicklung das Maß der religiösen Einwirkung gleich überzeugend veranschaulichen kann, wie die universalhistorische Gegenprobe: Warum entstand nirgends sonst in der Welt Kapitalismus in unserm Sinne?“ [24] Gemeint sind ‚Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus‘ und ,Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus‘.
Die erste ausführliche Auseinandersetzung mit Webers China-Studie ist die des Sinologen und Diplomaten Arthur von Rosthorn, den Weber gekannt und mit dem er korrespondiert hatte (vgl. unten, S. 42 f.). Der Beitrag von Rosthorns, der unter dem Titel „Religion und Wirtschaft in China“ in der „Erinnerungsgabe für Max Weber“ im Jahre 1923 erschien,
95
ist jedoch keine Auseinandersetzung mit der erweiterten, „Konfuzianismus und Taoismus“ betitelten, sondern mit der im „Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik“ erschienenen Fassung von 1915. Von Rosthorn ist „der Meinung, daß der kausale Zusammenhang von Religion und Wirtschaft überhaupt“ von Weber verkannt worden sei, und er will in seiner Darlegung diese Meinung begründen. Rosthorn, Arthur von, Religion und Wirtschaft in China, in: Hauptprobleme der Soziologie. Erinnerungsgabe für Max Weber, Band 2. – München und Leipzig: Duncker & Humblot 1923, S. 219–233.
96
Schon die Grundthese vom Zusammenhang zwischen Glaubensvorstellungen und „dem Aufschwung des modernen Geschäftslebens und der kapitalistischen Produktion“ lehnt von Rosthorn ab, Rosthorns Einlassungen zu einzelnen sachlichen Fragen und seine Kritik an Weber sind unter dem Gesichtspunkt wissenschaftsgeschichtlicher Fragestellung durchaus interessant, brauchen hier aber nicht aufgegriffen zu werden.
97
und er fragt, ob dieser Aufschwung nicht „vielmehr eine Folge der technischen Fortschritte und Erfindungen, der Erschließung großer Kontinente und des gesteigerten Verkehrs“ gewesen sei, Ebd., S. 232.
98
und ob nicht „die maritime Lage der protestantischen Länder, ihre Tüchtigkeit als Seefahrer, ihr Fleiß und ihre Zähigkeit als Folge eines schärferen Kampfes ums Dasein mit ihrem Aufschwung mehr tun [hat] als ihre religiöse oder moralische Einstellung“.Ebd.
99
Dies führt ihn zu einem Hinweis auf die regionalen Unterschiede in China und insbesondere zu dem Gegensatz zwischen Norden und Süden, in dem er „die Wurzeln des wirtschaftlichen Lebens aufgedeckt“ zu haben glaubt. Ebd.
100
Freilich sei „auch die geistige Disposition im Norden und im Süden eine etwas verschiedene gewesen.“ Und von Rosthorns These gipfelt in den Sätzen: „Der nüchterne, weltbejahende und sittlich strenge Konfuzianer ist der Ausdruck der nordischen Denkungsart; der müde, weltabgewandte, kontemplative Taoismus entspricht mehr dem Naturell des Südländers. Aber sicherlich hat hier nicht die Religion die [25]Wirtschaft beeinflußt, sondern beide, Religion und Wirtschaft, sind die Produkte gemeinsamer Bedingungen: des Bodens, des Klimas und vielleicht auch der Mischung des Blutes!“ Ebd.
101
[25] Ebd.
Arthur von Rosthorns Kritik haben sich auf lange Zeit keine weiteren Besprechungen von sinologischer Seite beigesellt; jedoch ist Webers Studie Über Konfuzianismus und Taoismus von sinologischer Seite durchaus zur Kenntnis genommen worden und hat einige Sinologen erheblich beeinflußt. Dies gilt im deutschen Sprachraum insbesondere für Stefan Balázs,
102
und später dann für den angelsächsischen Bereich. Außerhalb der sinologischen Fachkreise hat die Kritik von Rosthorns sicherlich mit dazu beigetragen, daß die Studie Max Webers wenig Beachtung gefunden hat. Julius Braunthal zitiert in seinem in der „Sozialdemokratischen Monatsschrift“ „Der Kampf“ im Jahre 1925 erschienenen Artikel „Ökonomische und soziale Wurzeln des chinesischen Risorgimento“ Webers Arbeit zwar häufig und lobt sie als „das weitaus Bedeutendste und Aufschlußreichste der über chinesische Wirtschaftsgeschichte vorliegenden Literatur“, Siehe hierzu Trauzettel, Rolf, Stabilität und Kontinuität der chinesischen Gesellschaft. Bemerkungen zum Werk des Sinologen Étienne Balázs (1905–1963), in: Saeculum 18, 1967, S. 264–277.
103
doch erscheint ihm auch die Lektüre der Abhandlung von Rosthorns „zur Korrektur [von] Webers Studie unumgänglich notwendig“. Braunthal, Julius, Ökonomische und soziale Wurzeln des chinesischen Risorgimento, in: Der Kampf. Sozialdemokratische Monatsschrift, Jg. 18, Nummer 8/9 (August-September 1925), S. 307–323, hier S. 309, Anm. 6.
104
Ebd.
Karl August Wittfogel bezeichnet in seinem Buch „Das erwachende China“
105
Max Webers Antwort auf die Frage, „warum China keinen selbständigen Industriekapitalismus hatte“, als „Sammelsurium-Lösung“, Wittfogel, Karl August, Das erwachende China. Ein Abriß der Geschichte und der gegenwärtigen Probleme Chinas. – Wien: Agis-Verlag 1926.
106
und schreibt etwas später: „Der Hauptmangel des Buches liegt […] in der undialektisch-unmarxistischen Methode, die trotz aller glänzenden Einzelheiten das Zustandekommen eines materialistischen Geschichtsbildes unmöglich macht. Das Buch ist ein Trümmerhaufen einzelner wertvoller Geschichtstatsachen, keine Geschichte. […] Immerhin ist Weber der einzige bürgerliche Historiker, der überhaupt ernsthaft die Frage aufgeworfen hat, warum China nicht selbständig zum industriellen Kapitalismus kam. Seine eklektisch-unmarxistische Methode hat ihn dann allerdings gehindert, eine ausreichende Antwort auf die von ihm richtig als Kernproblem erkannte Frage zu finden.“ Ebd., S. 159, Anm. 1.
107
Ebd., S. 161.